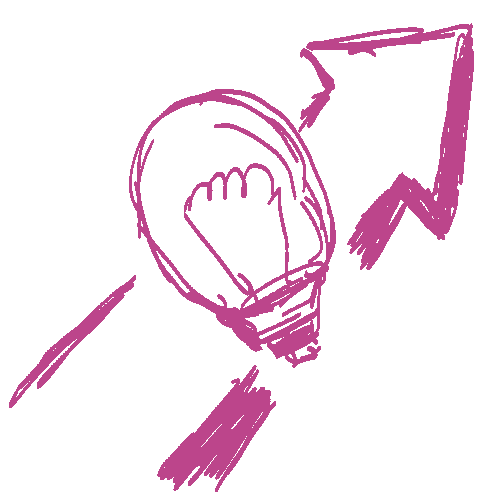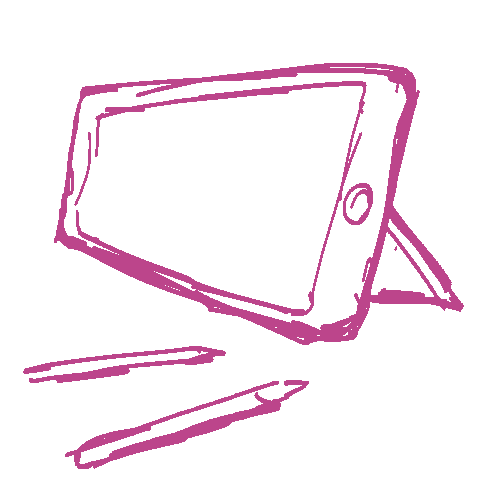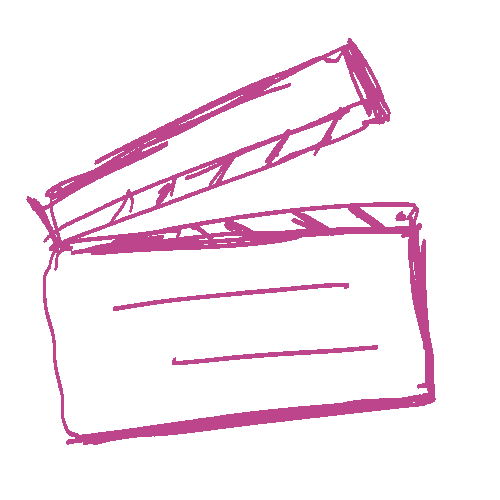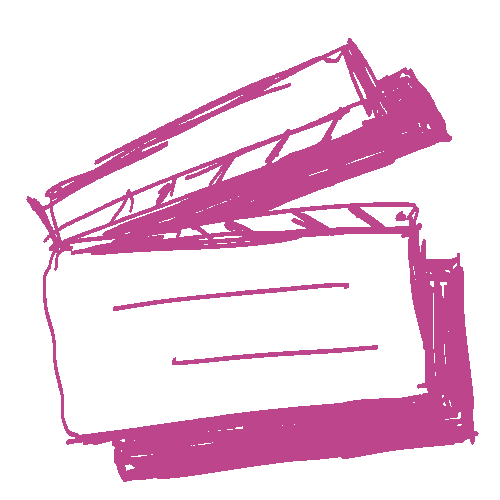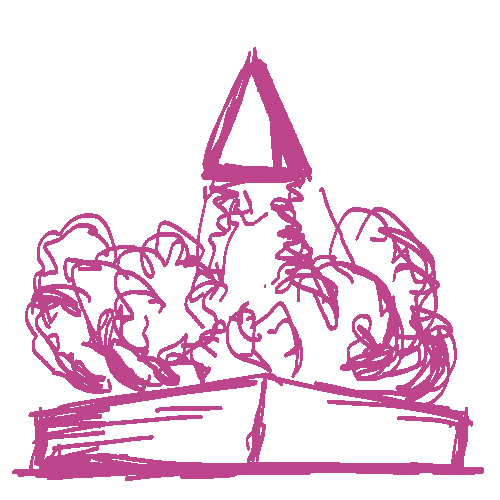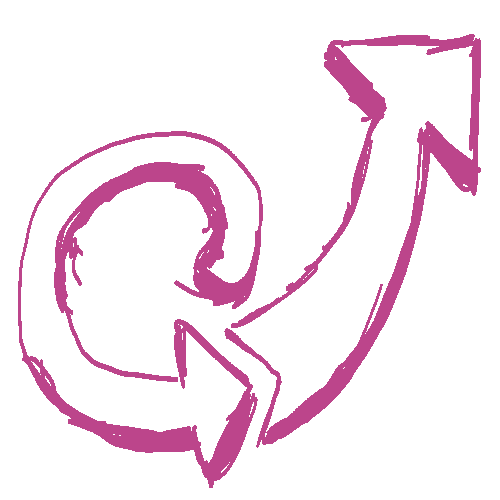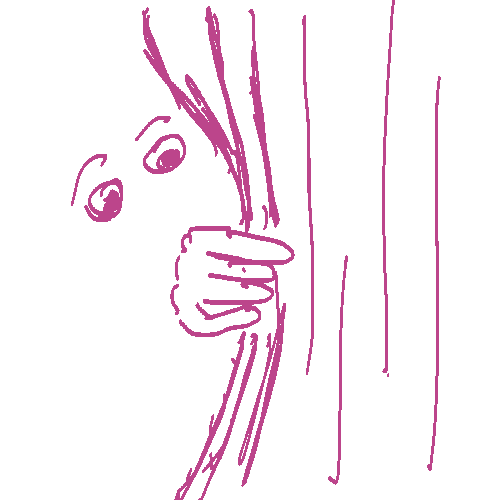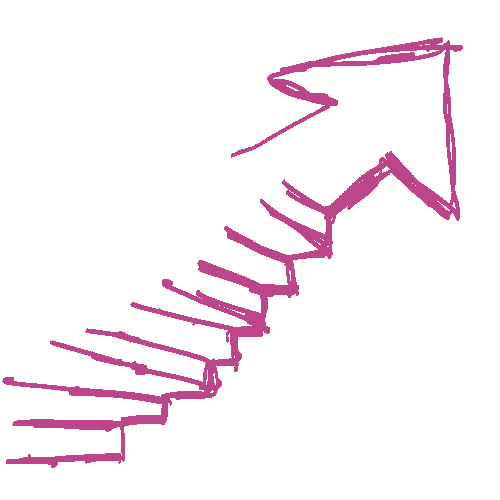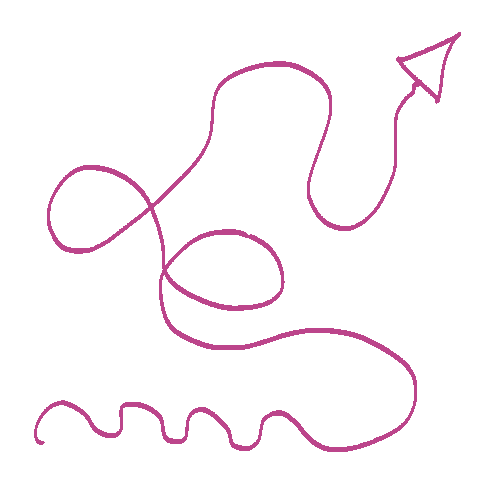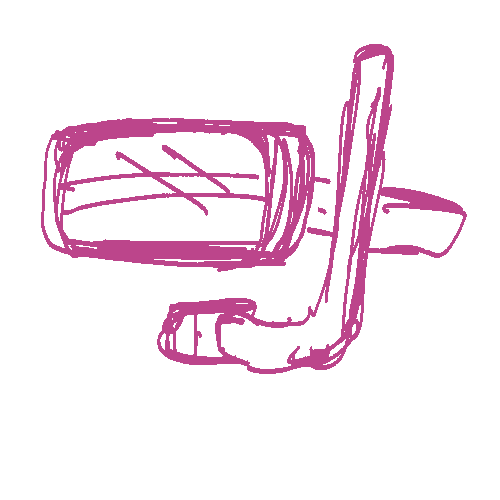Ein Beispiel für geringe Medienkompetenz allerseits — zw. Verletzung der Privatsphäre, Reality-Star-Sein + Privatheit als Geschäft, Exhibitionismus und Voyeurismus, Sender und Empfänger sowie den Sozialen Medien.
Ja, richtig gelesen: Heute geht’s auf den Boulevard. Aber auch dieses Feld gehört zu dem, was man »die Medien« nennt. Das Paar und das Geschehen um die beiden ist zweifellos (aus vielerlei Gründen) populär. Es ist (auch oder daher) ein anschauliches Beispiel für die Mechanismen der oder (besser:) einiger Medien oder (besser:) von Kommunikation sowie das Maß bzw. die Aufprägung medialer Kompetenz nicht zuletzt öffentlicher Personen.
Anlass für diesen Blogbeitrag ist die jüngste wohl nicht-autorisierte oder je nach Quelle womöglich vom Paar geduldete oder mit Distanz begegnete Publikation eines Buches über die beiden und ihr Ausscheiden aus der königlichen Familie. Ein Ausscheiden, welches die beiden (unabhängig von besagtem Buch) nach eigenen Aussagen auch oder besonders zum Schutz vor medialem Druck vollzogen haben.
Die aber über dieses Buch hinaus erreichte und wohl auch letztlich (siehe »Geschäftsmodell« der beiden, dazu später mehr) erwünschte Publicity lässt vermuten — so die These des folgenden Textes —, dass kommunikative bzw. mediale Mechanismen von den beiden und/oder ihren Beratern nicht in Gänze verstanden wurden und werden. Und oder mindestens, dass das Geschäftsmodell der beiden auf einem unüberwindbaren Widerspruch bzw. Konflikt gründet. Der mag vielleicht kommerziell erfolgreich sein, aber — vorausgesetzt Teile der Begründung, warum die restliche Familie in Sachen offizieller Funktion hinter sich gelassen wurde, sind echt — den beiden kaum Zufriedenheit bringen dürfte.
Um all dies solide zu beschreiben, müssen wir etwas und über das als Beispiel fungierende Paar hinaus ausholen — wer hier auf intime Einblicke das Paar betreffend hofft, muss also bereits in dieser Einleitung enttäuscht werden. Das Paar ist ein Aufhänger für die Auseinandersetzung mit medialen Mechanismen. Zudem: Wie in diesem Blog üblich gilt die Prämisse, dass es mehr braucht als ein paar Zeilen, um etwas zu erläutern.
Kommunikation und Medien — notwendige Grundlagen
Ganz grundsätzlich braucht Kommunikation mindestens »zwei«! »Zwei was?« — Personen, Institutionen etc. Diese befinden sich in einem wechselseitigen Prozess miteinander — vereinfacht: Der eine will etwas, der andere soll etwas machen. Vielleicht die Meinung ändern, vielleicht Brötchen holen, vielleicht, dass in einer Stunde der Braten aus dem Offen geholt werden muss. Im vorliegenden Fall — bei Harry und Meghan — geht es darum, dass einerseits für kommerzielle und wohltätige und/oder gesellschaftsrelevante Ziele Aufmerksamkeit erzeugt werden soll. Meghan hat als schwarze Frau sicherlich viel aus ihrem Lebens- und Berufsalltag zu erzählen und an anderen (ggf. jüngere) Menschen weiterzugeben — in einer Welt, in der geschlechtsbezogene als auch (Wenn der Begriff eigentlich aufzugeben ist, weil es ja keine menschlichen Rassen gibt, sondern nur Menschen:) rassistische Diskriminierung bedauerlicherweise noch lange nicht vom Tisch sind.
Gleichsam: Harry und Meghan wollen auf ihre — durch bestimmte Teile der Öffentlichkeit oder durch »die Medien« verursachte — schwierige Lage, auf die Rücksichtslosigkeit im Umgang mit ihrem Privatleben öffentlich aufmerksam machen. Wir werden das und das Paradoxe darin noch im Detail behandeln. Auch werden wir sehen, dass die Personifikation »die Medien« eine Vereinfachung ist, die verstellt, wie Kommunikation funktioniert.
Damit das Gesendete eine Chance hat, verstanden und ferner umgesetzt zu werden, muss der, der »angesprochen« wird, die verbale, akustische oder audiovisuelle, in Mimik oder Gestik verpackte Nachricht erst einmal grundsätzlich verarbeiten können. Und das ist noch gar nicht auf den Inhalt bezogen! Jedenfalls braucht es eine Basis — zum Beispiel, indem man die gleiche Sprache spricht und/oder (bzw. noch besser:) die Mechanismen von Kommunikation und Medien versteht. »Chance« beschreibt es bereits: Dass sich der volle Erfolg von Kommunikation einstellt, wie es sich der Sender gewünscht hat, ist nicht immer, gar nur selten der Fall. Folglich: Nur selten wird etwas im Zuge von Kommunikation vom Empfänger 1:1 umgesetzt. Vielleicht wird teilweise etwas umgesetzt oder alles missverstanden oder etwas ganz anderes »gemacht« — weil man ihm, dem Sender nicht zustimmt, in Reaktanz, im Trotz vielleicht sogar gar nichts unternimmt, vielleicht vergrößert sich Widerstand gegenüber Message und Sender sogar usw. Denn selbst die formal gleiche Sprache ist keine Garantie und damit haben wir auch eine explizit inhaltliche Komponente vor Augen: »Hurenkind!« — Beleidigung, kumpelhafter Ausdruck oder Fachbegriff der Typografie?
Das liegt — abseits von konkretem Wissen — auch oder vor allem daran, dass bei Menschen nicht einfach auf Knöpfe gedrückt werden kann. Obschon das immer noch ein verbreiteter Glaube ist. Dennoch: Es gibt bestimmte Dinge, die natürlich erfolgsbegünstigenden gelten. Sie basieren meist auf dem Menschsein an sich, auf Vereinbarungen bzw. Konventionen innerhalb einer Gruppe, einer Gesellschaft oder Kultur usw. Heute gilt etwa blau als männliche, rot als weibliche Farbe. Das war noch vor einigen Jahrhunderten umgekehrt.
Die Heldenreise wird sehr vereinfacht im Marketing und Storytelling als Möglichkeit betrachtet, erfolgreich Geschichten zu erzählen. Weil doch die Heldenreise einerseits einen archaischen Kern besitzt und dieser bei allen Menschen zu finden ist. Und andererseits, weil die Heldenreise über große Blockbuster etc. weitreichend (unterbewusst) verinnerlicht wurde.
Kommunikation »sichtbar« von Mensch zu Mensch berührt uns besonders — gerade das macht Soziale Medien sicherlich interessant, weil sie suggerieren, man »treffe« sich mit oder höre von einer privaten Person Privates. Dazu und auch wie unreflektiert der Umgang mit Sozialen Medien ist — im Verlauf dieses Textes mehr. Hier sei bereits gesagt, »sozial« sind diese nicht, was einen »guten« Umgang miteinander angeht, sondern weil sie einen relativ direkten Austausch zw. Menschen etc. ermöglichen. Diese Unterscheidung leuchtet angesichts von etwaigen Pöbeleien via Sozialer Medien sicherlich ein.
Der große Erfolg Sozialer Medien beruht der Erfahrung des Autors nach auf vier problematischen Umständen bzw. Annahmen: Soziale Medien bzw. sogar das Internet an und für sich wurde/n um die Jahrtausendwende vorschnell als demokratie-unterstützend verstanden (1). Das mag zweispaltig zw. informativen Plattformen und aufklärenden Autoren einerseits und Mobbing etc. anderseits auch so gekommen sein. Dann gelten Soziale Medien als interessant, weil sie zum einen (eben wiederum demokratisch auslegbare) Aktivität fördern — also vereinfacht, »dass man sich beteiligt« (2.1). Und zum anderen, dass mit ihnen institutionalisierte Medien umgangen werden können — wie es so manch unseriösen Politiker wohl erfreut (2.2). Das alles erweist sich allerdings als problematisch, weil ein nicht unerheblicher Teil der Nutzer*innen Sozialer Medien sie eher passiv nutzen, sich also im Flow von Empfehlungen und Weiterleitungen treiben lassen. Übrigens fällt es vielen Menschen schwer, sich stets bewusst zu entscheiden, auch deshalb finden sich auf Streamingdiensten Bestenlisten etc. Damit ist, trotz vieler freizugänglicher und fundierter Informationsquellen, heute auch nicht eine bessere Informiertheit zu beobachten. Gerade in dieser Zeit sind unterstützende, und zwar institutionalisierte Medien mit ihren Fähigkeiten zur Aufbereitung wichtiger denn je. Des Weiteren ist zu beobachten, dass Soziale Medien überschätzt werden — seitens der Werbeindustrie und von Investoren (3). Oft schreiben soziale Platfformen tatsächlich rote Zahlen. Werbung verteilt sich eben auch auf wahnsinnig viele Medien, was die Erlöse oft schrumpfen lässt, die Infrastruktur ist überdies teuer. Und die Werbung anhand einzelner Personen — zuvor prominente oder durch ihre Soziale-Medien-Aktivität zu Promis gewordenen Personen — ist risikobehaftet, da sogenannte »Testimonials« durchaus negativ auslegbar sind (dazu später am Rande mehr). Übrigen heißt das alles nicht, auch die Bedeutung Sozialer Medien was Wahlen angeht, wird überschätzt — und damit kommen wir zum letzten Punkt: Soziale Medien sind nicht grundsätzlich schlecht oder verrohend, dennoch beruht ihr Erfolg nicht nur auf dem Interesse der Menschen an der Privatheit anderer oder dem (vermeintlichen) Face-to-Face-Austausch, er beruht auch darauf, dass Medienkompetenz so gering ausgeprägt ist (4). Also, Produktplatzierungen nicht erkannt werden, simulierte (dazu später) Privatheit nicht erkannt wird oder Provokationen und Lautsein unreflektiert hingenommen werden. Und in Bezug auf Wahlen werden reflexartig falsche Informationen geteilt. Damit fehlt es an einer Kernkompetenz bei Jung und Alt für Gegenwart und Zukunft gleichermaßen. — Damit sind Soziale Medien nicht »schlecht«, aber eben auch nicht »besser«.
Aber damit nicht genug: Lebenserfahrungen, das konkrete Umfeld, Stimmungslagen, persönliche Vorlieben, Fähigkeiten, körperlich-geistige Gegebenheiten usw. spielen allesamt eine Rolle. Das kann zu bewussten oder unbewussten Entscheidungen führen — eben auch zur Ablehnung einer Message UND/ODER der Art und Weise, wie sie transportiert oder gestaltet wurde: Einladung ohne handschriftlichen Gruß ≈ ein tendenzielles No-Go, weil unpersönlich und nach Massenabfertigung »riechend«; Text auf einer Präsentationsfolie vorlesen ≈ empirisch belegbar ein No-Go, weil das individuelle Lesen und das Tempo des Vorlesenden kollidieren usw. Ziemlich klar also, dass Erfolg in der Kommunikation nicht garantiert werden kann. Und auch, dass der Glaube, »nur der Inhalt zählt«, eine naïve Annahme ist.
Kommunikation »sichtbar« von Mensch zu Mensch berührt uns besonders — gerade das macht Soziale Medien sicherlich interessant, weil sie suggerieren, man »treffe« sich mit oder höre von einer privaten Person Privates. Dazu und auch wie unreflektiert der Umgang mit Sozialen Medien ist im Verlauf dieses Textes mehr.
Verstehen genauso wie Nicht-Verstehen, Gefallen oder Nicht-Gefallen sind letztlich bereits Arten von Feedback. Insofern ist der Rezipient, also der Empfänger, nur selten passiv — er verarbeitet mal mehr mal weniger das an ihn »Gesendete«, weil er es nicht versteht, es ihm nicht »in den Kram« passt usw. Und umgekehrt ist der initiative Sender nie nur pauschal aktiv: Auch er muss zuhören und etwa überlegen, ob er seine Message nun anders vermitteln sollte oder warum seine Annahmen nicht von allen geteilt werden. Begriffe wie »Sender« und »Empfänger« sind verbreitete, und zwar kausale Vorstellungen (dazu später mehr) von Kommunikation, die aber nur und wenn überhaupt kurze Momente lang Gültigkeit haben. Vielmehr muss man von einem wechselseitigen Prozess ausgehen.
Das betrifft auch den Begriff »Massenmedien«: Das Wort ist nicht negativ auszulegen (≈ »dumme Masse«), sondern meint institutionalisierte und redaktionelle Systeme, die sich an ein großes Publikum oder (heute meist) spezifischere, relativ große Publika richten. Und da haben wir es schon: Der Gegensatz zu Massenmedien ist nicht der Einzelnen, der heute via Internet selbst publiziert, sich mit dem eher fragwürdigen, die ambivalenten Absichten beinahe klar ausdrückenden Begriff »Influencer« schmückt (dazu später mehr). Schon gar nicht ein passiver Empfänger, der einfach beeinflusst wird. Wie bereits gesehen es ist von wechselseitigen Prozessen auszugehen, deren Erfolg alles andere als garantiert ist. Und Sie wissen alle, dass Influencer theoretisch bzw. mit Blick auf ihre Follower durchaus große Publika erreichen können. Insgesamt lässt sich sagen: Alle Medien sind daher Spiegel ihre mal größeren, mal kleineren Umwelten, von individuellen oder institutionalisierten Eindrücken und Wahrnehmungen UND ihrer Rezipienten SOWIE von deren Interessen und Wünschen. Denen passen sich diese Medien nämlich an (und zu denen zählen eben auch jene nicht in die Schublade »Massenmedien« gehörenden Form wie Soziale Medien).
Alle Medien sind Spiegel ihre mal größeren, mal kleineren Umwelten, von individuellen oder institutionalisierten Eindrücken und Wahrnehmungen UND ihrer Rezipienten SOWIE von deren Interessen und Wünschen. Denen passen sich diese Medien nämlich an (und zu denen zählen eben auch jene nicht in die Schublade »Massenmedien« gehörenden Form wie Soziale Medien).
Und klar, dann prägen Medien unsere Welt oder jeden Einzelnen — über die Überschriften der großen Tageszeitung spricht man ggf. am Arbeitsplatz, aber auch — je nach Reichweite — über den jüngsten Post eines Influencers. Die Follower sprechen über das Thema, das den Influencer beschäftigt … Und dieses Thema hat er sich vielleicht aus seiner Zielgruppe »geholt«, aus den Kommentaren. Dieses Thema kommt vielleicht aus den Massenmedien oder wird umgekehrt später von jenen aufgegriffen usw.
Wesentlicher Unterschied zw. direkt anmutenden, eben Sozialen Medien und diesen institutionalisierten Medien ist aber, dass redaktionelle Medien gerade in Deutschland weitreichende Unabhängigkeit genießen und durch Ausbildung und Mehraugenprinzipien eine Aufbereitung, ein Erklären und Filtern sowie Überprüfen von Nachrichten übernehmen können. Das kann zwar auch Einzelnen gelingen, nicht aber, wenn man sich ganz unreflektiert Influencer nennt — zum problematischen Begriff wie gesagt später mehr.
Ein für Kommunikation unabdingbares Element wurde hier in diesem Text bereits ganz selbstverständlich und nebenbei genannt: exemplarisch als Sprache. Und Sprache ist ein Medium. Und Sprache ist nur eines von vielen Medien. Etwas, das zw. den beiden Kom.-Partner steht. Damit Kommunikation überhaupt möglich ist, braucht es mindestens ein Medium, meist sind es mehrere Medien auf differenten technisch-physikalischen und symbolisch-konventionalisierten Ebenen.
Damit Kommunikation überhaupt möglich ist, braucht es mindestens ein Medium, meist sind es mehrere Medien auf differenten technisch-physikalischen und symbolisch-konventionalisierten Ebenen.
In vielerlei Hinsicht ist das Digitale also zunächst eine technische Komponente. Lesen zum Beispiel ist ein relativ medien-unabhängige Fähigkeit, Sprache in Textform zu rezipieren — in vielerlei Hinsicht unerheblich, ob Tablett oder Papier. Keine Kommunikation kommt also ohne Medien aus — und sei es Luft, um Ton (damit das Medium Sprache > eine bestimmte Sprache > eine milieu-spezifische Sprache (z. B. Wissenschaft vs. Alltag) usw.) zu transportieren.
Aber das war es dann auch mit der Transport- oder Container-Metapher: Jedes Medium hat Eigenarten und die vermeintlich »nur« transportierte Botschaft etc. wird von ihnen mitgestaltet: Im Sturm kommt Ton schlechter an oder mit Sprache ein Bild zu beschreiben, Sie können es sich vorstellen, das hat Grenzen. Dennoch entsteht durch ein Medium und anhand der vermeintlichen Fähigkeiten es betreffend ein mehr oder minder stabiler, und zwar realer oder virtueller Raum: Man spricht eine ähnliche Sprache, man trifft sich in einem Chatraum, einer virtuellen Realität.
Übrigens, der heutige Gebrauch von »digital« meint oft genug »virtuell«. Zwar mag eine Videokonferenz heute meist auf digitaler Technik beruhen, eine Videoschalte war bereits vor über 70 Jahren möglich und ist daher besser als virtueller Raum zu beschreiben, in dem ich die Gesprächspartner zeitweise befinden, den sie während des Gesprächs quasi teilen. Der Vorgang selbst ist ein Eintauchen, die Immersion: Wir lassen uns auf die Regeln des Open-World-Games ein oder die den Austausch in einem Klassenraum betreffend usw. — oder auch nicht.
»Vermeintlich« sagt es bereits, vielfach sind mediale Fähigkeiten von Kindheitstagen an unterbewusst trainiert worden, oft können kommunikative Mechanismen und Eigenarten von Medien daher nicht bewusst benannt werden: Kommunizieren ist, wie ja so oft in diesem Blog zu erklären versucht, eben nicht wie das Atmen, nicht selbstverständlich, auch wenn man es vermeintlich kann. Die nicht nur am Beispiel von Meghan und Harry im Folgenden gezeigten medialen und kommunikativen Phänomene werden das illustrieren.
Kommunikation gelingt regelmäßig also nur vermeintlich und ist von diversen Missverständnissen durchzogen. Auch in Bezug auf ihre Funktionsweise. Und das ist, so die These dieses Blog-Eintrages, auch bei Meghan und Harry sowie ihren Beratern womöglich der Fall.
Yellow Press — (für Harry) das Schlechteste der »Medien«
Harry beruft sich regelmäßig auch in seiner (wie gleich hier ebenfalls gezeigt wird: teilweise berechtigten, wenn auch undifferenzierten) Kritik an den Medien auf das Leben seiner Mutter — diese war bekanntlich großem medialen Druck ausgesetzt. Vielleicht waren es gerade ihre zweifellos nicht immer schönen Lebensumstände, die die Begriffe »Paparazzo« bzw. plural »Paparazzi« (leider, möchte man ergänzen) weitreichen bekannt gemacht haben: Sie und auch ihre Kinder, der junge Harry, wurden unentwegt von der Regenbogenpresse belagert, mit Teleobjektiven und unter regelmäßiger Verletzung der Privatsphäre sowie bisweilen der Grenzen privaten Eigentums. In bedauerlich konsequenterweise waren es u. a. auch solche Yellow Press beauftragten oder mit dieser ein Geschäft erwartende Paparazzi, die in den Tod von Harrys Mutter verwickelt waren.
Um es bereits jetzt deutlich zu sagen respektive zu schreiben, natürlich kann und darf Harry sich über seine Familie und sein Leben äußern: Es ist seine Sache. Sehr wahrscheinlich haben ihn diese Ereignisse und ihre schrecklichen Konsequenzen sehr geprägt und mindestens diese Art der Presse ist für ihn dauerhaft negativ aufgeladen. Mehr als verständlich.
Das Verhältnis des Paars zu den Medien ist aber in zweifacher Hinsicht problematisch: Die stete Referenz auf das Schicksal seiner Mutter — wie gesagt, natürlich steht es den beiden bzw. Harry frei, davon zu sprechen — ist problematisch angesichts von der Regelmäßigkeit und dem Grad, wie er bzw. die beiden es machen: Wenn man sich denn ein Privatleben wünscht. Diesbezüglich mag eine Faustregel so lauten: »Umso mehr man preisgibt, umso mehr lädt man andere ein, hier insbesondere die Yellow Press, ins Private ›reinzukommen‹. Man macht sich für ihre nicht zuletzt auch unseriöse Berichterstattung anfällig (≈ Deutung kleinster Details, Erfindung von Kontext) und damit angreifbar (≈ es betrifft ja Privates).«
Das kann (ohne hier juristische Begriffe zu benutzen oder eine Rechtsberatung vollziehen zu wollen) soweit gehen, dass die Grenze zur Privatsphäre aufweicht. Man könnte argumentieren, die Tür zu ihr ist ja durch das eigene Tun geöffnet worden. Ob das Verhalten von aggressiven Yellow-Press-Formaten diesbezüglich, also sich einer mehr oder minder deutlichen Einladung folgend hineinzudrängen, richtig ist, steht auf einem anderen Blatt bzw. ist hochdiskutabel.
Jedenfalls: Harry lädt mit dem wiederholten Einblick in seine Gefühlswelt, seine Motive sowie sein persönliches Schicksal ein, mehr zu erfahren — eben nicht nur bei diesen Blättern, sondern auch deren Kunden und sogar über diese Zielgruppe hinaus. Dazu später mehr. Aber richtig, man könnte immer noch an dieser Stelle sagen: »Weiter möchte ich darüber nicht sprechen!« Allerdings gehen Harry und Meghan (wie gesagt) regelmäßig über dieses Level hinaus. Warum? Und damit kommen wir zum zweiten fragwürdigen Punkt: nämlich zum Geschäftsmodell der beiden. Das Private ist (zumindest teilweise) das Geschäftsmodell, mindestens der Aufhänger von Harry und Meghan, um für die eigene — auch wohltätige — Agenda Aufmerksamkeit zu erzeugen. Übrigens, es ist hier zwar nicht der Platz über die Ambivalenz dieser Absicht zu sprechen, Nennung sollte sie finden: die wohlfahrtsindustriell anmutende Zielsetzung der beiden mit wohltätigem Engagement überdurchschnittlichen Lebensstandard letztlich auch (über bereits vorhandenes Vermögen hinaus) zu erhalten — etwa in Form auch bezahlter Dokus und Auftritte.
Privatheit als (paradoxes, auch kommerzielles) Produkt (des Paares)
Über viele SchauspielerInnen, RegisseureInnen oder PolitikerInnen — alle samt regelmäßig in der Öffentlichkeit, in Filmen, auf Festivals, in Interviews — ist im Grunde wenig bekannt. Deren Privatleben ist, was es ist: privat. Grobes wurde genannt, ggf. auch Schicksalsschläge, aber Details nennen die besagten Personen, wenn überhaupt, dann nur wenige. Sie wehren sich ggf. sogar erfolgreich juristisch gegen etwaige Berichte oder Fotos zum Beispiel ihre Kinder betreffend — nicht nur können sie argumentieren, dass Kinder ohnehin auch eigene Rechte haben, sie können auch darauf verweisen, dass sie ihre Kinder nicht öffentlich vorgestellt haben: Sie einfach in die Öffentlichkeit zu zerren, ist dann also für etwaige Blätter gar nicht so leicht.
Sicherlich ist das bei Harry und Meghan natürlich in gewisser Weise anders — als Teil der königlichen Familie hatten beide und damit auch ihr gemeinsamer Sohn (bisher — bis zum Ausstieg) nicht die Wahl, sich grundsätzlich von der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Die Familie des britischen Souveräns ist eben partiell steuerfinanziert und damit stets im öffentlichen Blick, erfüllt Funktionen, die nicht immer ihren individuellen Meinungen und Wünschen entsprechen — dazu muss man nicht (das zweifellos in seiner Darstellung fiktionalisierte, dramatisierte, vielleicht in Teilen in der Überspitzung ‚was Mechanismen angeht, durchaustendenziell akurate Serienformat) The Crown gesehen haben. Es ist ein Spiel zw. Distanz und Nähe: Projektionsfläche und Vorbildfunktion für die Bevölkerung, »erhabener« Repräsentant ———Identifikationsfigur, Vertrautheit, »eine/r von uns« sein.
Diese Ausgangslage rechtfertigt natürlich nicht das oben bereits im Falle von Diana skizzierte Ausmaß aggressiver Annäherung. Zwar sind auf dem Weg zu dieser Eskalation durchaus Verhaltensweisen auf beiden Seiten auszumachen, die den Prozess nicht gerade entschärft haben. Das legitimiert aber nicht die Überschreitung von Grenzen seitens der Regenbogenpresse. Opfer dieser Art von Sensationsberichterstattung sollen hier also nicht als mit-schuldig erklärt werden. Vielmehr geht es im Folgenden darum — im Sinne von Medienkompetenz, im Sinne von Aufklärung — Prozesse zu behandeln, die mehr oder minder im Umgang mit einem rigorosen Teil der medialen Welt (≈ Yellow Press in diesem Fall) unbewusst in Gang gesetzt werden können.
Das — das nicht-einfache Beschuldigen — sollte auch »die Medien« betreffend gelten. Denn zunächst: Es gibt sie nicht, »die Medien« — jedenfalls nicht im Sinne dieser pauschalen Personalisierung. Sie sind Menschen oder meist menschengemacht — zw. Individuum und Institution, Kommerz, Aufklärung, rücksichtlosen Instinkt und verantwortungsvollen Einsatz. Wir alle sind Medien, an Medien beteiligt — im Zuge leistungsstarker Endgeräte mehr denn je. Das entlässt die professionellen Medienmacher nicht von ihrer Verantwortung, sondern betont selbige sogar. Letztlich muss daher oder auch festgehalten werden, nicht alle professionellen Medienmacher besitzen die negativ-rigorose Attitüde der Boulevardmedien oder bestimmter Formen innerhalb dieser. Denn gewiss sollten auch diese nicht über einen Kamm geschoren werden — denn es gibt teilweise ein gegenseitiges Nutznießer-tum zw. Berichtenden und den in den Magazinen betrachteten Personen, dazu später mehr.
Was aber ganz definitiv im Fall des Paares, also Harry und Meghan, anders gegenüber besagten Prominenten mit einem »low profile« in Sachen Privatheit ist, dass die beschriebenen Personen zwar »was mit Medien machen« und von der oder einer Öffentlichkeit, einer Zielgruppe leben — sie leben vom kommerziellen Erfolg ihrer Filme, von der künstlerischen Anerkennung ihrer Werke (durch Feuilletons, Auszeichnungen). Ihr Einkommen basiert damit nicht notwendigerweise auf ihnen als Privatperson, sondern auf einem von ihnen gelieferten Produkt, wenn auch das nicht immer greifbar ist. Es ist ein Film, eine schauspielerische Leistung oder die Vertretung von Interessen oder Wählern zum Beispiel etc.
Jetzt ist er bereits vielfach gebraucht worden, der Begriff »privat«. Er benötigt, obschon sich sicherlich jeder etwas darunter vorstellen kann, etwas Kontext — wie so häufig gilt auch hier, dass meist mehr in einem Begriff steckt, als man denkt: Zunächst steht Privatheit meist Öffentlichkeit gegenüber. Öffentlichkeit meint eine recht freie Zugänglichkeit — ein öffentlicher Platz zum Beispiel. Selbst der Weg zur heimischen Haustür ist in partieller Weise öffentlich — das ist nicht juristisch gemeint, sondern im Sinne, dass dort jemand Fremdes zu Tür kommt und sei es, um ein Paket zuzustellen. Es ist dann eine kleine Öffentlichkeit, könnte man sagen.
Öffentlichkeit, selbst im Sinne von Tausenden bis Millionen von Menschen, ist mehr oder minder stufenweise mit Schranken versehen und heute kleinteiliger gegenüber jenen Zeiten zum Beispiel, in denen es nur ein oder zwei TV-Sender gab. Dort — auf einer bestimmten Plattform in Internet — kann man ein vollständiges Profil eines anderen Menschen sehen, ohne sich anzumelden, da nur nach Registrierung oder wenn man befreundet ist.
Je nach Plattform und/oder Einstellung des Profilinhabers also gibt es Stufen der Erreichbarkeit und des Zugangs. Das heißt, privat ist auch eine geschäftliche Email an XY, da — theoretisch — nur XY sie lesen kann: ≈ privat-geschäftlich also. Das Sprechen auf einer Konferenz ist semiöffentlich, weil vielleicht nur für geladene Gäste gedacht. Ein Interview im öffentlich-rechtlichen (und damit Free-)TV ist potenziell sehr öffentlich, weil recht gut von jedem empfangbar. Privat ist dann aber auch eine private (zum Beispiel nicht-berufliche) E‑Mail an Z, weil nur sie sie lesen kann; das private Social-Media-Profil hingegen ist je nach Einstellungen mehr oder weniger öffentlich, weil durch andere mehr oder weniger zugänglich.
Öffentlichkeit bzw. weniger Privatheit ist hier also zunächst eine Frage der Medien bzw. in Teilen der konkreten Mediennutzung und des Medienzugangs: Eine Massen-E-Mail ist öffentlicher als eine E‑Mail an nur eine Person. Manch Berufstätige ist in einer breiten Öffentlichkeit unbekannt, Ihre Expertise hingegen ist einer kleinen und bestimmten Öffentlichkeit dagegen sehr wohl vertraut.
Bisher geht es also nicht um den Content oder Inhalt. Das ist dann eine weitere Form von Privatheit — Privatheit als Inhalt: In der Firma weiß man nichts über die Hobbys von Person K, noch wie er am Strand aussieht. Seine privaten Gefühle teilt man sicherlich nicht in Gänze seinem Chef mit etc.
Das, was man als privat definiert oder was so aussehen soll (dazu später mehr), kann mehr oder weniger bewusst preisgegeben werden — wir kommen noch darauf zu sprechen, dass die Sozialen Medien bisweilen einen gewissen Zwang zur Offenbarung menschlicher Intimität oder der Illusion von ihr, der Intimität und ihrer Preisgabe, in sich tragen.
Jedenfalls: Die beiden beschriebenen Privatheiten hängen natürlich partiell zusammen. Die Nutzung eines Mediums bedingt ja den Inhalt, das Transportierte mit — vereinfacht: Was einem als sehr intim gilt und man nur mit bestimmten Personen teilen möchte, sollte nicht auf ein Profil gestellt werden. Möchte man etwas vielen Menschen mitteilen — aus einer gegenüber dem Beruf/der Öffentlichkeit privaten Welt oder gegenüber der kleinen Öffentlichkeit »Familie« zum Beispiel — lohnt sich vielleicht eine Anzeige in einer Tageszeitung zur Geburt eines Kindes etwa.
Und auf dieser Content-Ebene steht das Private dann dem Beruf vermeintlich gegenüber. Wobei Beruf wiederum eine Form von Öffentlichkeit repräsentiert. Wie gesagt private Ansichten sind ggf. in der Firma nicht gefragt. Der Beruf findet zuhause keine Anwendung oder sollte der Familie zuliebe in Teilen »draußen« bleiben. Soweit theoretisch.
Auch hier gibt es mannigfaltige Schnittstellen: Gravierende Problem zuhause lassen den oder die eine im Büro nicht los, sorgen für Gereiztheit gegenüber Kollegen. Mancher kann zuhause nicht abschalten oder einfach am Ende der Arbeitszeit den »Stift fallen lassen«, da die Aufgaben zu groß sind. Insofern dringen öffentliche Aspekte zuhause ein. Übriges natürlich auch durch das Betrachten von Nachrichten etc. Wir lassen all das so stehen, denn Bewertungen sind hier fehl am Platz: Gesunde Informiertheit kann privat und beruflich zur gesellschaftlichen Teilhabe beitragen. Einseitige Quellenwahl kann dafür sorgen, dass die Welt einseitig, vielleicht als gefährlich wahrgenommen wird — und das insgesamt, beruflich und privat. Gerade um so etwas besser zu verhindern, ist ein Mehr an Medienkompetenz sinnvoll.
Die Trennung von Beruf und Privatheit ist selbstverständlich — das stand bereits zw. den Zeilen — eine individuelle Leistung bzw. von der individuellen Situation abhängig. Manch einer hat sein Hobby zum Beruf gemacht — da sind die Grenzen dann fließend. Und dennoch kann die Unterscheidung bei der Betrachtung von Medien und mit Blick auf Meghan und Harry hilfreich und weiterhin sinnvoll sein: Wie gesagt ist es eine Frage individueller Definition und partiell spielen hier mehr oder minder sinnvolle bzw. ggf. hinterfragbare gesellschaftliche Konventionen eine Rolle, Privates zu definieren. Versteht man persönliche und private Einsichten, familiäre Beziehungsfragen als tendenziell privaten Content, nutzt diesen jedoch auch für kommerzielle Interessen, vereinen sich Beruf und Privatheit zu einem erheblichen Teil.
Auch das ist natürlich eine individuelle Entscheidung — aber in diesem Blog geht es ja darum, zu fragen, ob sich manch Mensch, der so ein Geschäftsmodell betreibt, sich der Tragweite der dazugehörigen Entscheidung bewusst ist. Und aus Sicht der Follower, ob da nicht etwas Undurchdachtes zu beobachten ist oder eine bisweilen gekonnte Masche zur Anwendung gebracht wird — etwa, wenn sich ein Reality-TV-Star beschwert, dass das Leben in der Öffentlichkeit nicht leicht sei.
Ein wenig wie Reality Stars … Privatheit als Produkt II
Wir haben schon ansatzweise den Vergleich zu Berufsfelder gezogen, die nicht einfach nur öffentlich sind, weil man für eine Firma arbeitet, sondern die automatisch eine große Öffentlichkeit erreichen, etwa als SchauspielerIn, und knüpfen hier daran an: Während zum Beispiel klassische Schauspieler sich oft und regelmäßig auch wohltätig für andere Menschen stark machen, können sie stets darauf verweisen, dass ihrer Arbeit sie populär gemacht hat. Diese Arbeit nun habe, quasi im Nebeneffekt, ihnen als hinter der beruflichen Performance stehenden Menschen Gehör verschafft, welches sie eben wohltätig nutzen. Es gibt also weiterhin eine Grenze zum Privaten: Als Privatperson nehmen sie sich einer weiteren Performance — eben für ein wohltätiges Anliegen — an. Und »Performance« meint hier nicht, dass etwaiger Engagement nur gespielt ist: Jeder Mensch nimmt stetig Rollen ein — zuhause liebevolle Mutter, im Betrieb souveräne Chefin usw.
Kommerziell und in Sachen Wohltätigkeit ist es dann sehr anders, wenn die Privatheit das Produkt ist und gar in vielen Teilen gleich »echter« Privatheit ist. Vielleicht veranschaulicht die Betrachtung eines bekannten Feldes, was diese Ausführungen zum besagten Geschäftsmodell meinen: Widmen wir uns daher dem Reality-Star-Dasein, zu dem mehr oder weniger Social-Media-Stars und/oder (weil oft deckungsgleich) sogenannte Influencer zählen können: Ihr mehr oder minder privates Leben ist das, was die Leute sich ansehen wollen oder sollen bzw. das preisgeben wird. Bereits allerseits gewohnte Zeichen dafür sind das Berichten aus einem privaten Raum, in privater Kleidung, Mikrophon sichtbar, ggf. auch ein hochkantes Bild.
Das Ganze wird dann natürlich mit Werbung und/oder Produktplatzierungen und/oder Formen von Fiktion kombiniert — sonst würde es nicht lukrativ oder fesselnd genug sein: Man bietet etwas, das von Werbung unterbrochen wird. An den so generierten Einnahmen der Plattform wird man beteiligt. Man empfiehlt etwas — wobei nicht immer ganz eindeutig zu erkennen ist, ob es sich um eine persönliche Präferenz oder eine bezahlte Gegenleistung handelt. Und allzu klar soll es auch nicht sein.
Das hat dazu geführt, dass heute eine Kennzeichnungspflicht solcher mehr oder minder versteckten Absichten besteht. Die Gegenleistung Dritter soll markiert werden. Der Erfolg dieser Maßnahme darf aber zu bezweifeln sein, weil — im Sinne parasozialer Interaktion oder des Meinungsführer-Modells — Empfehlungen von konkreten, sichtbaren (im Sinne von Face-to-Face-Kom. oder Im Sinne von »realen«) Menschen in der Regel auf andere Menschen einen hohen oder wahrscheinlichen Einfluss ausüben — wenn man nicht wie hier darüber reflektiert. Der Empfehlende muss man also nicht mal in natura getroffen haben, es muss sich dabei nicht einmal um eine reale Person handeln. Es ist sogar unerheblich, wenn besagte Empfehlung nur das Ergebnis einer Inszenierung ist. Viel zu schnell wird der Fokus vom Ball auf den Spieler gelenkt, könnte man sagen. Der Mensch ist so gesehen ein durchschlagendes Medium, weil wir eben Menschen sind.
Solche Beziehungen sind übrigens längst vor der Erfindung der sogenannten Sozialen Medien möglich gewesen, beobachtet worden und sind heute noch allgegenwertig: In gewisser Weise haben viele oder wohl die meisten Menschen schon einmal eine Beziehungen dieser Art gehabt — zu ausgedachten Leinwandfiguren und Helden von Hörspielen, TV-Persönlichkeiten, Comic-Figuren: weil man sich mit ihnen identifiziert, weil sie einem wie ein beliebter Nachrichtensprecher auch durch eine gewisse (serielle) Regelmäßigkeit vertraut sind.
Insofern ist das Private, von dem hier gesprochen wird, nicht notwendigerweise ein echtes, das volle oder ungefilterte Private. Es ist teilweise bewusst oder unbewusst inszeniert oder wird womöglich imaginiert, man stellt sich vor, wie »der wohl privat ist«. Nicht zuletzt ist das Private nicht immer das wahre Private, weil Beobachtung das Beobachtete verändert. Das Dokumentieren — selbst wenn es neutral sein will — nimmt Einfluss. Oft, weil die begleiteten Menschen sich der Begleitung ja bewusst sind. Und: Medien sind eben nicht einfach Transporteure, darauf haben wir implizit eingangs bereits verwiesen: Denken Sie daran, schon die Kameraperspektive oder die Ausrichtung des Gerätes verändert das Gesehene: Hochkant ≈ Generation Z, mobiltauglich und gewohnt, auch mal eher amateurhaft, privat ——— horizontal gehalten ≈ Kino, TV, inszeniert, professionell, erfordert den Nutzerschritt des Smartphone-Drehens für die Vollbilddarstellung.
Der Begriff »Scripting« steht insbesondere für die absichtsvolle und/oder wohldurchdachte Inszenierung. Scripting meint im vorliegenden Fall — in Bezug auf Reality TV — wenn eine bewegtmedial begleitete Familie pro Folge etwas Bestimmtes macht, ist das Geschehen nicht unbedingt aus der Familie heraus entstanden. Das Leben ist zwar in gewisser Weise und bekanntlich eine Ansammlung von Episoden oder Phasen — Kindergarten, Schule, Oberstufe; der Bau des Gartenhaues, der Kauf eines Autos etc. Aber nur schwerlich passt solch eine mehr oder minder große Episode stets in eine Episode einer entsprechenden Serie bzw. in eine vorgegebene Laufzeit oder eine online eingestellte »Story«.
Was nun also pro Folge geschieht, basiert lose auf einer Art Script, einem Drehbuch. Um von Folge zu Folge etwas zu bieten. Die Reaktion auf das geplante Vorhaben — ›Es muss jetzt ein Hochbeet angelegt werden!‹ — sind dann mehr oder minder real. ›Unterstützend‹ wird ggf. so gefragt (aus dem Off durch den/die RedakteurIn oder den/die AutorIn, ohne dass die Frage es in die fertige Folge schafft): »Erzähl doch mal, warum Du glaubst, Deiner Frau durch den Bau eine Freude zu machen.« Die Antwort darauf sehen wird dann.
Auf Plattformen der Sozialen Medien werden von den Influencer selbst oder ihrem Stab entsprechende Abläufe konzipiert, bisweilen gar mit Teleprompter, Kameraleuten und Maske inszeniert — der Klassiker: vermeintlich ungeschminkt eine Schminkempfehlung geben.
Wie immer sollten nie alle über einen Kamm geschert werden: Aber mittlerweile gibt es ganze Bürokomplexe voller Ministudios für Influencer: eingerichtet wie Jugendzimmer oder, da sich natürlich auch an Erwachsene richtend, wie private Wohnräume aussehend. Dort arbeiten dann die Influencer, entsprechend privat gekleidet. Es gibt Berater in solchen Angelegenheiten, die in Sachen Seriosität nach Meinung des Autors dieses Blogs fragwürdige Kurse anbieten — mit dem Versprechen, via Sozialer Medien schnell Geld zu machen.
Das alles ist diskutabel — weil man ohne verantwortungsvolle Reflektion »macht, was läuft« ≈ jeder will plötzlich angeblich Social Media und ggf. dort Star werden, also gibt es Anbieter die oft kostenintensive Kurse dazu anbieten; »Ich will Influencer werden«, komme nicht an, weil ich mache, was schon alle machen oder störe mich nachher am Verlust meiner Privatheit usw. Hier werden Lücken in Sachen Medienkompetenz überdeutlich. Anderseits ist das alles aber vor allem ein Indikator dafür, dass sich hier eine Industrie etabliert hat, die sicherlich in Sachen Profession nicht klassischen Medien nachsteht und schon lange nicht mehr unter das »Neue« in Neue Medien passt. Zumindest was Abläufe und Produktion angeht. Schon bei klassischen Medien ist Reflektion nicht immer gegeben, da oft — zw. vorteilhaft und problematisch — Menschen dort arbeiten, die keine dezidiert mediale Schulung erhalten haben. Jedenfalls: Die »Veränderung« durch die Medien der Beobachtung beschränken den Blick auf so etwas wie eine Realität oder im vorliegenden Fall das reale Leben der Beobachteten:
Realität ist nicht gleich Realität — Exkurs zu Hintergründen
Dass das beobachtete Private, selbst wenn es aus den eigenen Wänden gefilmt wird und sich eine Person höchst selbst via Twitter äußert, nicht immer die volle Privatheit ist, haben wir bereits gesehen. Weitergedacht: Es ist — im Sinne des medientheoretischen Konstruktivismus, im Sinne ›Mensch als Medium‹, an diversen Medien beteiligt, von div. »Seelen in [seiner] Brust« gefordert — zu fragen, ob er/sie/div. überhaupt weiß, was seine oder die Realität ist. Und das betrifft Sender und Empfänger (auch oder gerade, weil die beiden Größen austauschbar sind, in einem wechselseitigen Prozess stehen). Jeder kreiert quasi eine eigene Welt. Und sogar noch weitergedacht, lässt sich fragen, ob wir sie, eine oder die Realität, erkennen können und wollen. Denn wie gesagt es funktioniert auch im Rahmen von Inszenierungen: Wir haben jemanden, dem wir mit Sympathie begegnen, an dessen Leben wir teilhaben wollen, den wir bewundern usw. Wie das Konzept der Immersion (hier mehr zu ihr) verdeutlich, Ungewolltes oder in diesem Fall der Umstand, dass etwas inszeniert ist, kann von uns mehr oder minder bewusst ignoriert oder ausgeblendet werden. Wir tauchen dennoch ein.
Bevor nun — partiell zu Recht — entgegengehalten wird, damit ist die Frage nach Privatheit doch überflüssig, weil immer nur ein Konstrukt: Privatheit ist damit »nur« eine Vorstellung über eine private Person — erdacht durch den Beobachtenden; eine mal mit Scripten, mal unterbewusst (als Angeben vor Freunden) erfolgende Inszenierung des Privaten durch die Person selbst usw. Insofern muss auf dieser medien-wissenschaftlichen und ‑philosophischen Ebene richtigerweise, aber nur vorläufig festgehalten werden: Privatheit ist ein schwammiges Konzept, ein Hilfskonstrukt.
Es geht aber in diesem Blog-Eintrag um Medienkompetenz. Das ist ein dem wiederholt Lesenden bekanntes Anliegen des Autors dieses Blogs: Erst wer weiß, warum etwas ist, wie es ist, kann auch das Wie souverän und verantwortungsvoll anwenden. Das meint hier, man kann sich selbstverständlich zur Entspannung seinem geliebten Influencer hingeben, wird dann aber nicht mehr unbedingt von jeder Werbebotschaft vereinnahmt — weil man eben weiß, wie das Business oder besser noch, wie Kommunikaiton funktioniert.
Wenn auch die Kategorien »das Private« ein wenig greifbares Konzept ist, man sich klar machen muss, dass jeder über die gerade via Instagram beobachtbare Privatheit eigene Schlüsse zieht, es umgekehrt fraglich ist, ob das Gesehene frei von Inszenierung ist, zumindest sehr selektiv sein dürfte, bleibt die Unterscheidung privat (hier im Sinne von Intimität) vs. öffentlich auf einer alltäglichen Ebene weiterhin sinnvoll: Gerade wenn man mal auf konkrete Informationen schaut — ein überspitztes Beispiel: Möchte man einen Streit mit einem Lebenspartner öffentlich machen? Kommentare von Unbekannten dazu erhalten? Eine individuelle Entscheidung (und eine Frage des Geschäftsmodells), aber sicherlich werden manche Lesenden solche eine Situation zw. den »Konfliktparteien« behalten und damit »intern« abwickeln wollen.
Und: Sehr wohl gibt es viele persönlich geprägte/erstellte Realitäten, es existiert aber umgekehrt durchaus eine Art interpersoneller Raum und eine Vorstellung über die Welt, eine Art gemeinsame Sphäre. Diese könnte so — anhand wachsender Medienkompetenz — bewusster mit-gestaltet oder zumindest erkannt werden. Oder anders gesagt, wir brauchen einen gemeinsamen Raum, um miteinander auszukommen: Menschliche Vielfältigkeit ist ein Zustand und natürlich zugleich eine Quelle großer Kraft. Gleichsam müssen wir friedlich miteinander auskommen und gemeinsam Probleme lösen und damit offen für gemeinsame Basen sein.
Mit mobilen Endgeräten, dem zeitlich, örtlich und im Volumen unbegrenzten Internetzugang wird das auf mehr oder weniger öffentlich (je nach Registrierung, je nach Freischaltung gegenüber nicht-angemeldeten, nicht-befreundeten Nutzern) zugänglichen Plattformen angegebene Private — als Content sozusagen, die Privatheit also — semiprivat und semiöffentlich zugleich, irgendwo dazwischen. Zumindest, wenn man es denn so will — vielleicht also mal bei Partymachen unter Freunden ohne Fotografieren durch den Abend: Zwar gehen schöne Momente als Dateikonserve eher verloren, Kompromittierendes aber auch — das kann auch ein Freundschaftsdienst sein.
Das Verlangen nach der Privatheit anderer — eine naiv-kausale Annahme
Bevor es wie so oft als Ausdruck eine fortwährenden Generationenkonflikts heißt, »es geht bergab mit der Welt«: Nicht erst im Zuge von Sozialen Medien, der freiwilligen oder anhand des Punktesammelns in die Welt getragener oder etwaigen Unternehmen überlassener, privater Informationen, hat sich der Glaube über die Kunden von etwaigen Boulevardblättern hinaus gefestigt, man müsste über viele Menschen etwas Privates wissen oder hätte in einzelnen Fällen (gleich dazu) sogar ein Recht darauf. Obschon hier sicherlich im Zuge des Web 2.0 eine Verstärkung festzustellen ist.
Ein noch recht dem Boulevard nahes Beispiel zeigt, dass wir hier nicht mit etwas Neuem konfrontiert sind, höchstens mit etwas, dass sich in seiner Qualität (im Sinne von Eigenschaft) verändert hat: In den 1920er bis 1950er Jahren wurde die US-Filmindustrie aus Hollywood gelenkt. Das Geschäftsmodell dabei: das Studio- bzw. Star-System. Konkurrierende Unternehmen banden Stars langfristig an sich. Sie durften dann nicht mehr für die Konkurrenz arbeiten, mussten Filme in »ihrem Studio« drehen. Das System scheiterte schließlich, weil die Kreativität unter diesem Modell gelitten hatte und neue Stars nicht unbedingt nachkamen oder nachkommen konnten. Sättigung stellt sich ein. Die Studios jedenfalls langzierten bereits damals Meldungen über ihre Stars und deren Privatleben, manches wurde dabei gar inszeniert. Die Stars waren vielleicht mehr als heute die Vermarktungsgrundlage eines Films oder sie sollten es sein, inklusive mehr oder minder »echter« Privatheit und nur bedingt freiwillig.
Woran liegt das, also warum wird oder wurde die Grenze zum Privaten durchbrochen? Das ist ein vielschichtiger Komplex. Wir kommen später noch auf weitere Facetten zurück — zunächst soll an dieser Stelle gezeigt werden, welche Denkmechanismen hinter diesem Phänomen stecken können. Dazu kann ein theoretisches Konzept eine Erklärung bieten: Betrachtet man zum Beispiel die Systemtheorie — manchmal als Supertheorien bezeichnet, weil sie die soziale, kommunikative, kulturelle und ökonomische Welt bzw. entsprechende Welten zu beschreiben versucht — wird klar: Alles hängt zusammen, nichts hängt zusammen.
Das heißt, vieles ist komplexer, denn man denkt. Es lohnt sich — wie hier im Blog immer wieder versucht — Dinge ganzheitlich bzw. in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. Aber: Vieles entsteht aus überkomplexen bzw. chaotischen Umständen heraus anstatt absichtsvoll. Insofern kann nicht alles als Kette vorgestellt werden, ja selbst als Netz nicht (was ohnehin oft oberflächlich betrachtet zu sehr nach Verschwörung klingt): Sie kennen alle diesen Spruch vom Flügelschlag eines Schmetterlings, der auf der anderen Seite der Welt einen Sturm auslöst. Das mag sein, aber tragen Sie, wenn Sie an einer Pflanze vorbeigehen, auf der der Schmetterling sitzt, und damit von Ihnen aufscheucht »flattert«, Verantwortung für den dann womöglich entstehenden Sturm? Wohl kaum.
Mag im Kleinen Kausalität für Menschen ein funktionierendes Weltmodell sein — Lichtschalter gedrückt, Licht an. Bei größeren Themen hat Kausalität jedoch Grenzen. Denn kausales Denken hat schon früher dazu geführt, einfachen Schlussfolgerungen zu verfallen. Und tut es immer noch.
Und damit zurück zum Thema und zu einem weiteren Beispiel, das wohl recht alt sein dürfte: »Verheirate = privat stabil = beruflich stabil«. Dass solche Vorstellungen nicht auf solidem Fundament stehen, dazu braucht man nicht erst die Scheidungsstatistik zu betrachten. Was jemand privat macht, wird von vielen nach wie vor als Indikator zum Beispiel für den Beruf gesehen — und umgekehrt. So soll aus dem Hobby ggf. abgeleitet werden, wie es um den Bewerber — im Bewerbungsprozess also — insgesamt bestellt ist.
Aus Sicht des Autors dieses Blog bleiben — über Statistiken hinaus — aber mehr denn wenige Zweifel an dieser Zusammenziehung. Obschon sie damit nicht pauschal aussagelose werden, so sollte bedacht werden: Mensch nehmen oft diverse Rollen im Leben, oft sogar parallel ein; sie sind gar einem Medium oder vielen Medien ähnlich — zuhause ist er so, unter alten Freunden anders. Insofern kann es durchaus sein, dass jemand, der erfolgreich ein Unternehmen managt, privat eher ein schlampiger Typ ist. Es gibt Facetten und Bereichen, die, wenn sie auch mechanisch einander ähnlich sind, vom vielschichtigen Individuum als ganz unterschiedlich wahrgenommen werden und der- oder demjenigen sehr unterschiedlich liegen …
Nichtsdestotrotz wird die Grenze zw. Beruf und Privatheit regelmäßig durchbrochen: Gerade Sonntage werden vermehrt genutzt werden (Richtig, viele Menschen arbeiten ohnehin an diesem Tag, der Tag ist hier exemplarisch gemeint:), um über Plattformen wie Xing und LinkedIn Menschen beruflich zu kontaktieren. Die Prämisse dabei ist, sie so besser erreichen zu können: Weil sie mehr Zeit haben für eventuelle Gerätschaften bzw. Plattformen. Hier wird das Thema Medienkompetenz überdeutlich: Fügen sich alle einfach dieser Kontaktprämisse — weil es vermeintlich alle machen, es funktioniert — und lassen das Verfahren über sich ergehen mit der Konsequenz, dass Beruf und Privates vermengt werden?
Solch eine Nutzerbrille, also das Hineinversetzen in den oder die Andere, ist mit Vorsicht zu genießen: Zumindest diagnostiziert man der sogenannten »Generation Z« ein größeres Bedürfnis nach Trennung von Beruf und Privatheit. Vielleicht endet damit die sonntägliche Belastung. Und wer selbige übrigens jetzt schon nicht will, sollte als aktiver Rezipient vielleicht in der Freizeit an einen herangetragene Beratungsangebote etc. quasi aktiv ignorieren, indem er die berufliche Vernetzungsplattform am Sonntag außen vorlässt … Daher kann es umgekehrt nicht einfach heißen, wir sind den so Medien nutzenden, realen und fiktiven Menschen ausgeliefert: Es kann kein 1:1‑Erfolg solcher Maßnahmen angenommen werden. Die Welt ist, die Menschen sind sehr komplex: Dass etwas, ein kommunikativer Vorgang, wirkt, wie er vom Sender beabsichtigt wird, ist tendenziell die Aufnahme und unwahrscheinlich. Denn sonst würde ja jede Werbekampagne den Umsatz unermesslich steigern. Dem ist nicht so — und dabei spielt Medienkompetenz nur eine Rolle unter vielen Faktoren. Sie ist nämlich nach Erfahrung des Autors dieses Blogs kaum bis gar nicht verbreitet. Kommunikation scheitert (im Sinne von »etwas an den Mann bringen«) vielmehr regelmäßig, weil eben nicht für jeden Menschen eine maßgeschneiderte Botschaft erzeugt wird und absehbar erzeugt werden kann.
Was bringt die Privatheit anderer? Zw. Voyeurismus und Orientierung
Mehr oder minder dokumentarisch, mehr oder weniger real betrachten wir in genannten Reality-Fällen oder auch in Bezug auf Meghan und Harry etwas von anderen Personen. Das hat grundsätzlich zwei, nicht einfach zu trennende »Wirkungs-« oder »Nutzen-«Dimensionen — Anführungsstriche, denn eine kausale Einflussnahme kann wie gesehen nie als 100%ig angenommen werden, noch ist Nutzen (auch das haben wir mehrfach impliziert) immer ein bewusster Vorgang: Voyeurismus ist da zuerst zu nennen. Sicherlich reizt das (vermeintlich) Private im Sinne von Unzugänglichkeit und doch nimmt man teil. Vielleicht liegt hier eine Form eines menschlichen oder zumindest kulturellen Tabubruchs vor.
Es braucht keine Wissenschaft, um zu wissen, dass Verbotenes einen besonderen Reiz ausübt. Als Mitdreißiger muss man sich nur an indizierte Videospiele um die Jahrtausendwende erinnern — gefühlt alle hatten sie. Wissenschaftlich lässt sich das etwa über das Konzept der Reaktanz erklären: Das Unerlaubte wird (unterbewusst) interpretiert, als sei einem die Freiheit der Entscheidung genommen worden. Die daraus resultierende Dissonanz — nicht mehr alles ist im Einklang, »es fehlt etwas« — soll dann überwunden werden und daher wird das (zunächst) Nicht-Erreichbare besonders erstrebenswert.
Weil es aber tatsächlich nur schwer oder gar nicht erreichbar ist, kann das Verbotene abgewertet werden, um die Dissonanz zu beseitigen: »Eh nicht wichtig!« Oder man will es von nun an unbedingt, um die angeblich verlorengegangene Freiheit wiederherzustellen. Das lässt sich natürlich auch nutzen: als künstliche Verknappung auf Produktebene. Eine Biermarke in klaren, statt grünen, Glasflaschen mit güldenem Inhalt hat das um 2003 herum so gemacht — streng begrenzt gab es das Getränk nur in ausgewählten Clubs und Gastronomie-Betrieben, was wiederum durch die Knappheit einen Reiz auslöste und letztlich wohl die großflächige, und zwar erfolgreiche Einführung begünstigte. Oder das Nicht-den-Mundschutz-Absetzen-Dürfen wird von Agitatoren zum Untergang der Freiheit schlechthin erklärt. Obschon — das gehört auch zur Reaktanz — das Thema, hier die Freiheit, einen, also die, die sich nun aufregen, vorher vielleicht gar nicht interessiert hat oder der wirkliche Optionsverlust nur gering oder im vorliegenden Fall der Mund- und Nasenbedeckungen vorübergehend ist und zudem ja der Freiheitsverlust bei der Demonstration gegen den Freiheitsverlust als nicht gegeben entlarvt wird — daher auch »angeblich«.
Daher oder (je nach dem:) überdies kann in Form dieser quasi-legitimen Kanalisierung des Tabubruchs eine Art ent-individualisierter Mensch entstehen, der quasi — immersiv, in einem Eintauchen (dazu hier mehr) — sich selbst verlässt, sich von sich selbst erholen kann oder eben mit Gleichgesinnten eine Erfahrung zu teilen scheint. Das mag etwas philosophisch klingen, meint aber letztlich eine Form von Empathie und/oder ein Gemeinschaftsbedürfnis und ‑gefühl. Dass das mit Blick auf die Mundschutz-Debatte und den Voyeurismus mehr als nur graustufig sein kann, erklärt sich von selbst. »Quasi-legitim« meint hier in Bezug auf Voyerismus, dass das Schnüffeln der Yellow Press zwar theoretisch als unschön gilt, aber diese Art von Informationsquellen (abseits etwaiger Verletzungen der Privatsphäre der Beobachteten) erstmal ungehindert erwerbbare Produkte hervorbringen. Hier ist also eine gewiss ambivalente Art von Ventilfunktion denkbar.
Dann ist hier ein Voyeurismus gemeint, um sich selbst (vermeintlich) besser einschätzen oder auch von anderen abgrenzen zu können. Man ergötzt sich ggfs. an anderen und auch subjektiv abgewerteten Sphären des Menschseins: an in Relation »unteren« Milieus oder im Falle der »Royals« an deren »Abgehobenheit«. Das mag nicht immer bewusst geschehen, aber dennoch eine Möglichkeit sein, warum man derartiges, also auch Boulevardmedien, rezipiert. Ist es den Rezipierenden bewusster, wird oft von einer ironischen Komponente gesprochen — quasi als eine Spielart des Trashs: »Das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist!«
Nochmal: Das sind Phänomene, über deren Ambivalenz sicherlich zu diskutieren ist und deren (ggf. asoziale, mindestens überhebliche) Ausformungen gewiss im Rahmen von Medienkompetenzschulungen thematisiert werden können — weil man sie sich bewusst macht, statt sie »einfach so« aktiv und passiv geschehen zu lassen.
Die zweite »Wirkung« bzw. der aus der Rezeption solcher Gerüchteküchen hervorgehende Nutzen steht in Bezug zur erstgenannten Ebene: Damit das Gezeigte — im TV oder auf etwaigen Plattformen — möglichst real wirkt, damit es möglichst vertraut rüberkommt, wird regelmäßig viel (mehr oder minder) Persönliches preisgegeben und zwar in der mehr oder weniger simuliert-virtuellen Form persönlicher Kommunikation von Mensch zu Mensch, das haben wir ja besprochen. So soll Intimität und Bindung zum Rezipienten begünstig werden. Und durchaus wird dabei Orientierung im Alltag oder zur Unterhaltung geboten: »Die sind wie ich!« »So will ich sein!« »So geht der das Problem an!« Das ist erst einmal hinzunehmen: Jeder wird sich in seinem Leben — bewusst oder nicht — das eine oder andere Mal an anderen orientiert haben, Rat gesucht haben. Auch das kann natürlich ambivalent sein — zw. positivem und negativem Vorbild. Jedenfalls soll damit (mit der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation) auch die Empfehlungskraft das Eingestreute betreffend gesteigert, zumindest das Verweilen begünstigt werden, um Werbeeinnahmen in Werbepausen oder als Banner zu verstärken.
Um Intimität herzustellen, wird auch — das kennen Sie sicherlich aus Alltagserfahrungen — zusehends viel und allerseits geduzt. Manchmal mag damit ein Verzicht auf Hierarchien und damit ein Beitrag zu einer egalitären Gesellschaft beabsichtigt sein. Das mag manch eine/r auch mit modernen Arbeitskonzepten verbinden. Aber es ist durchaus auch beim Duzen mehr zu beachten und ganzheitlicher zu denken: Im Corporate Wording mag es vorgesehen sein, …
Medienkompetenzen — das sei nochmals betont — sind also ausbaufähig: Es ist nämlich paradox, dass Menschen, die sich — nach eigener, regelmäßiger Aussage — nicht beeinflussen lassen wollen, Influencern folgen. Mit mehr Medienkompetenz würde — so ist sich der Autor dieses Blogs sicher — der Begriff »Influencer« mal mehr hinterfragt werden. Heute gibt es zum Beispiel keinen Propagandaministerien mehr, weil das einerseits modernen demokratischen Werten zuwiderläuft und dann, weil der Begriff negativ belegt ist: Derartige Ministerien dienten einer wenig vielschichtigen, wenig andere Meinungen zulassenden Kommunikation — meist im Sinne einer eher totalitären Ideologie. Auf vielen Wegen sollte ein bestimmtes Bild von etwas kreiert werden — etwa im Kriegsfall von einem Feind.
… um natürlich eine Verbindung zum Kunden zu erreichen und Zugänglichkeit für eigene Interesse beim Kunden zu begünstigen. Das kann problematisch werden, wenn man es nicht deutlich genug kommuniziert, dass man hier stets geduzt wird — viele mögen es nämlich weiterhin nicht. Und in Bezug auf modernes Arbeiten entsteht hier ein weiteres Problem: Kritik duzend vorgebracht wird schnell persönlich, beim »Sie« bleibt es (unterbewusst) auf die Stelle und Tätigkeit bezogen. Also Obacht.
Und ja, das ist heute nicht der Fall. Freie Meinungsäußerung ist einfacher denn je — eben auch, weil jeder selbst zum Produzenten werden kann. Und: Heute besteht durchaus die Möglichkeit, selbständig zu überprüfen, was an etwaigen Sachverhalten und Verschwörungstheorien wirklich dran ist. Aber: Der Erfahrung des Autors dieses Blogs nach wird — als Schattenseite diverser Medienkanäle (auch, aber nicht nur über das Internet), als Resultat einer überfordernden Flut — heute mehr denn je vieles einfach unhinterfragt übernommen und geteilt. Weil filternde oder überprüfende Größen wie redaktionelle Medien umgangen werden können. Das bedeutete nicht unbedingt Unabhängigkeit und Freiheit, sondern (wie gerade skizziert) dass die Masse auch an Falschinformationen nicht immer gefiltert wird. Diese Masse wächst sogar. Damit sind redaktionelle Medien also nicht obsolet, sondern wichtiger denn je. Gleiches gilt für Medienkompetenz: Damit man Handwerkszeug erhält, die Seriosität von Quellen soweit möglich überprüfen zu können. Und damit wird auch klar, nicht das Internet, also ein Medium, ist schuld, sondern wie bei allen Medien und ihrer Nutzung gilt es, sich an die eigene Nase zu fassen, selbstständig zu filtern, die eigene Verantwortung zu erkennen.
Jedenfalls: Propaganda ist negativ, warum sich also offensichtlich beeinflussen lassen? Der Begriff »Influencer« trägt seine Intention schließlich unverhohlen in sich — und ist damit zwar aus wissenschaftlicher Perspektive durchaus interessant, weil recht treffend. Er verweist nämlich auf das soziologisch angehauchte Meinungsführermodell, welches wiederum auf die Relevanz von zwischenmenschlicher Kommunikation in der Meinungsbildung Bezug nimmt. Der Blick auf diese zum »Opinion Leader« gehörende Untersuchung (um Lazarsfeld in den 1940ern wohlgemerkt entstanden) zeigt, dass die oft (gerade wieder aktuell, vorschnell und unsachlich) als manipulativ geltenden Massenmedien oder besser redaktionellen Medien weit weniger »Wirkung« entfalten, als man annimmt.
Deshalb sind wohl auch Soziale Medien mit ihren »Persönlichkeiten« so erfolgreich — interpersonelle, bisweilen Face-to-Face-Kommunikation, nur eben meist virtuell. Der überstrapazierte Begriff »Manipulation« kann also mindestens genauso, wenn nicht sogar mehr Sozialen Medien attestiert werden. Allerdings wird, nach Meinung des Autors dieses Blogs, derzeit so viel von Manipulation gesprochen, dass selbst das »Türaufhalten« oder das Gespräch an der Bushaltestelle als höchst manipulativ gelten müssten. Übersehen wird regelmäßig, dass ein Großteil jeder Kommunikation »etwas will«.
Jedenfalls: In der breiten Öffentlichkeit dürfte der Begriff »Influencer« — mit Blick auf den negativen Begriff »Propaganda« — doch, wenn man denn mal überlegt, was er bedeutet, wenig charmant wirken. Oder ist das Nicht-Hinterfragen des Begriffs das Resultat eben geringer Medienkompetenz? Oder eines verbreiteten Bedürfnisses allerseits danach, selbst AutorIn, KommunikatorIn und damit einhergehend zu einer entscheidenden Größe in Sachen Meinungsbildung zu werden? Das ist wohl ein möglicher (unterbewusster) Nutzen, den sich einige (unterbewusst) von dieser Tätigkeit versprechen. Und das wiederrum führt zu einem wichtigen Perspektivwechsel in Sachen Wirkung und Nutzen des Privaten:
Was das Senden von Privatheit den Sendenden bringt? Selbstdarstellung und mehr
Bisher haben wir Wirkungen und etwaigen Nutzen aus Perspektive der Rezipienten beschrieben, gleichwohl festgehalten, dass Produzent und Rezipient heute, mehr denn je oder immer schon, die Rollen tauschen können. Was also bringt das ggf. vollzogene oder graduelle Zurschaustellen dem- oder derjenigen, der/die es betreibt? Und das abseits von kommerziellen Interessen oder Wohltaten oder Auftragserteilungen als InfluencerIn für Unternehmen?
Exhibitionismus wäre hier ein Schlagwort. Ein Schlagwort, das angesichts seiner eigentlich negativen Aufladung aber vielleicht zu weit geht:
Es geht um ein Sich-selbst-Präsentieren. Weil jeder zunächst ein Individuum ist oder sein will. »Zunächst« deshalb, weil es zu den aus professioneller Sicht des Autors gehörenden Widersprüchen im Menschsein und in der Kommunikation zählt, dass viele genauso sehr eben auch dazugehören wollen. Influencer-Sein ist also zw. »es so machen, wie die anderen« und »sich abheben« einzuordnen.
Mit diesem Verweis aus das Selbstdarstellen ist kein Abgesang à la Zügellosigkeit gemeint, sondern ein vielschichtiges Phänomen: zw. freiheitlichen Möglichkeiten und Selbstdarstellung. Ein in Variation immer mal wieder gesendeter, von der Idee her schon alter Spot greift es auf: »Mein Haus, mein Boot … « Aber die Historie dieses Phänomens ist weit älter denn das Video — zum Beispiel: Die Geschlechtertürme im italienischen San Gimignano und daran wohl anschließend in Regensburg: Wer hatte den größten?
Es geht um ein ständiges Vergleichen — das kann sich »kleiner« im Zeigen von Kinderfotos unter Eltern und Großeltern ausdrücken, eben auch auf sozialen Plattformen. Welches Kind spricht denn schon wie gut Mandarin? Oder bei schulischen Jahrgangstreffen, bei denen — im Sinne ausgebliebener Reflexion — stets »die Anderen« gefragt werden, ob sie denn endlich Kind und Haus hätte oder im öffentlichen Dienst arbeiten würden, als sei das das einzig Erstrebsame oder Lebensmodel. Sicherlich zeigt sich hier also ein Sendebewusstsein am Werk, welches zwischen »Sieh her, was ich für eine bin; Du solltest mich bewundern« auf der einen und dem durchaus machtbezogenen »Ich bin Dir voraus, unerreichbar oder Dir ein Vorbild, gar über Dich hinaus ein Taktgeber« auf der anderen Seite schwangt. Aber: Wie so oft sind dies sicherlich unterbewusste Prozesse und nicht immer planvoll.
Übrigens zeigt sich hier auch bei Meghan und Harry wieder ein paradoxes Verhalten: Offizielle Bilder ihres Nachwuchses — das wollten sie nicht so recht, ein Bild der drei fehlte auf dem Tisch der Queen bei ihrer Weihnachtsansprache. Klar, ließe sich entgegen, das Kind sollte ja nicht in die Öffentlichkeit gezerrt werden, die schlechten Erfahrung insbesondere Harrys würden dies erklären. Über Soziale Medien, die dortigen Auftritte von Harry und Meghan, jedoch ist der Kleine sichtbar. Ist den beiden nicht klar, dass damit das Erreichte unterwandert wird? Der Kleine doch öffentlich wird? Oder ist das Ganze am Ende doch ein Ausdruck privater — familien-interner, aber eben paradoxerweise öffentlich werdender — Reibereien im Denkmantel höherer Ziele? Meint: Woll(t)en sich die beiden einfach nur nicht den Spielregeln der Familien und Höflinge unterordnen, erklären ihren Austritt aus der Familie aber nun mit (auch medienalen) Zwängen? Aber Paradoxien sind vielleicht der Kern des Menschseins und damit auch von Kommunikation.
Unterbewusst und so gar nicht neu sind dann auch die damit einhergehenden Phänomene oder entgegengesetzten Verhaltensweisen: Manch Mittdreißiger zieht sich wohl auch deshalb (wenn denn auch nicht nur wegen des bisweilen belanglosen Vergleichens) aus dem Sozialen Medien zurück. Vielleicht weil sich damit nie so ganz warm geworden sind, sie zu spät in ihr Leben traten. Dieses Abkapseln von etwas, und sei es einem populären Medium wie den sozialen, ist ebenso historisch nachvollziehbar: Nach der gescheiterten demokratischen Revolution 1848 hielten viele Menschen sich aus öffentlichen Debatten fern — wobei der Vergleich natürlich hingt: Ihnen wurde das Wort regelrecht verboten, viele wanderten aus, andere reagierten eben mit dem Rückzug ins Private. Heute ist dann eher davon zu sprechen, dass eben durch eine beisweilen aufgeladene — schwarz-weiße, mindestens regelmäßig von Bewertungen durchzogene — Atmosphäre der Meinngsäußerung einfach bei manchen kein Interesse mehr besteht, sich diesem auszusetzen. Bisweilen kann also von einer unbeherrschten Meinungsäußerung geprochen werden — exemplarisch, wenn heute mangelnde Meinungsfreiheit von einigen beklagt wird, während sie gerade ihre Meinung frei äußeren. Ist hier die von manchen Menschen kurz nach der Jahrtausendwende erhoffte Demokratisierung durch Netz und Soziale Medien als zu pauschal entlarvt worden? Das kann hier nicht abschließend geklärt werden: Das reaktante Nicht-Erkennen von Freiheit ist in seiner Paradoxie sicherlich auch im Sinne von Medien‑, gar Weltkompetenz zu behandeln.
Mit Blick auf die oft auch lautstarken Provokationen und Pöbeleien heutzutage im Internet ist ein Rückzug sicherlich verständlich, aber eben auch zwiespältig. In Teilen wird damit einer eigentlich oder zumindest wahrscheinlich kleinen aggressiven, aber (oder einhergehend:) lautstarken Gruppe ein Feld überlassen. Eben auch, das sei im Sinne des Anliegens des Autors dieses Blogbeitrags gesagt, weil Medienkompetenz fehlt, diesem Lauten auch in seriösen Medien weniger Platz einzuräumen und ungewollt als Verstärker kruder Messages zu dienen. Insofern ist es selbstverständlich legitim und sogar unterstützenswert, dass auch Harry und Meghan pöbelnden Größen gegenüber nicht einfach klein beigeben.
Hier ist insgesamt auch keine einfache Schelte des Influencer-tums angedacht. Der ambivalenten Begrifflichkeit und ggf. kommerziellen Note zum Trotz: Es gibt Social-Media-Stars, die lehrreiche und investigative Inhalte anschaulich publizieren, die dem jedem Menschen zustehenden Bedürfnis nach Entspannung gerecht werden. »Natürlich« werden sie an den durch ihren Kanal generierten Werbeeinnahmen beteiligt. Auch die investigative Presse kann nicht umsonst arbeiten — Gebühren, Abos, Werbefinanzierung. Und auch dort gibt es in Form bewusst »auftretender« Journalisten eine Art kommunizierte Rolle — bestimmte Kolumnen-Kanäle zum Beispiel.
Die leider durch die Medienindustrie unterstützte Umsonstkultur gerade im Internet beginnend mit der Jahrtausendwende hat mediale Werke an Wert verlieren lassen: »Umsonst« meint, weil vieles seitdem im Grunde frei verfügbar ist — eben zum Preis von Werbeschalten und heute mehrfacher Datenerfassung. Alles sollte über Werbung finanziert werden. Heute zeigt sich, das lässt sich immer weniger realisieren, da die Quoten oder Publika immer kleiner werden — da immer spezifischere Angebote und Milieus entstehen.
Umgekehrt gibt es auf allen Kanälen auch weiterhin erfolgreiche Kommunikation ohne eine aufdringliche oder vordergründige interpersonelle bzw. Face-to-Face-Note: Das heißt, es gibt Kanäle, die erklären oder allgemeiner etwas kommunizieren, ohne das eine bestimmte Person auftritt. Videos und Beträge können als Produkt einer Körperschaft wahrgenommen werden — vom »Artikel im Spiegel« zum Beispiel wird dann gesprochen oder in einer Doku tritt ein namenloser Erzähler auf: Das ist also ein Zwischending zur Face-to-Face-Kommunikation.
Allerdings werden dort eben nicht intime Inhalte geboten, kein Einblick in das (vermeintliche) Leben der Macher gegeben — was wiederum auf eine Trennung von Beruf und Privatheit auch in Form des vorhergehend genannten Schauspiel-Beispiel verweist.
»Insofern sind doch alle Schauspieler! Prominente, Reality Stars etc.« Richtig und doch nicht so ganz! Denn es bleibt dabei: Auch wenn hier — bei Influencern und auch Meghan und Harry — bisweilen eine Rolle wie im Schauspiel gespielt werden mag, sind die Grenzen zum Privaten weit fließender denn im Schauspiel. Vor allem wird in der einen Branche auf diese Trennung verwiesen, während sie im anderen Fall (trotz etwaiger Kennzeichnung) möglichst unentdeckt bleiben soll: So gibt es im Film einen Vorspann und/oder Abspann, ein Plakat, eine Kachel in der App des Streamingdienstes mit den realen Namen (/Künstlernamen) der agierenden Person. All das markiert, dass — so ist es zumindest den meisten bekannt — von einer realen Person eine Rolle gespielt wird. Es wird zwar mit der Person hinter der Rolle geworben, manchmal gibt es auch Werbeverträge über die Rolle hinaus als Testimonials zum Beispiel.
Übrigens sind Testimonials eine oft problematische Strategie: Einerseits scheint sie mit Blick auf das Meinungsführermodell Bewandtnis zu haben, weil manch Star alleine seines Erfolgs nach als ein Orientierungsfigur herhalten und auf das beworbene Produkt abstrahlen kann. Andererseits wird eben auch der Ausruf provoziert: »Haben die denn noch nicht genug!« Und wenn der- oder diejenige sich doch viel zur eigenen Privatheit äußert, werden entsprechende Lasten eben auch implizit Teil der Kampagne und des beworbenen Produktes.
Teilweise ähnlich wie im Influencertum ist Productplacement in Filmen keine Seltenheiten. Aber nicht zwangsläufig wird in einem privaten Sinne geworben. Es bleibt — je nach Entscheidung des Stars — tendenziell dabei: »Die spielt immer so gut, das muss ich auch den neuen Film sehen!« Es kann, muss aber nicht so kommen: »Der kocht so nett auf seinem Kanal, seinen Film muss ich gucken!« Warum? Weil eben ein relativ deutlich vom Privaten entferntes Produkt geboten wird — als Performance einer DarstellerIn zum Beispiel. Und das, diese Trennung, — es sei erneut betont — ist im Reality-Business nicht der Fall. Und eben auch nicht so recht bei Harry und Meghan — das Paar ist das Produkt.
Eine relativ gute Wirkung erzeugen Promis also eher bei sogenannten »peripheren Themen«. Das heißt, wenn wenig Themenbezug und Fachwissen bei den Rezipienten und der potenziellen Zielgruppe zum Produkt vorliegt. Anders sieht es dann schon bei Experten aus, die nur sehr spezifisch und wenn überhaupt für manche als Stars gelten ≈ Profigeräte werden exemplarisch von Profis vorgestellt. Wenn Fußballer Manuel Neuer also für eine Fotokamera wirbt, ist das ein Zeichen, dass man die Kamera an (Pro-)Amateure verkaufen möchte. Und auch dafür, dass man beim Hersteller des Gerätes glaubt, bei potentiellen Kunden auf sehr einfache Knöpfe drücken zu können. Mhh. Wenig überraschend ist der Einsatz von Testimonials erfahrungsgemäß auf den Wunsch von Geschäftsführung zurückzuführen und ebenso erfahrungsgemäß nicht von Profis der Kommunikation empfohlen worden.
Die Unterscheidung mag zwar wie gesehen in Sachen Immersion in einen Film oder einen Kanal oder in Sachen der Wirksamkeit von Kennzeichnungen nicht unbedingt einen Unterschied auf das Erlebnis der Rezipienten machen, ist aber ein formaleres oder etabliertes Zeichen für eine etwaige Trennung von privater und öffentlicher Sphäre. Und wie gesagt im Sinne von Medienkompetenz ein Wissen, welches — zumindest im Hinterkopf vorhanden — Manches hinterfragen lässt. Und sei es nur, dass dann vielleicht das Eintauchen bewusster gesteuert, weniger hingenommen oder nach dem Abschalten im Abtauchen auch mal reflektiert wird. Zumindest zeigt sich mit Blick auf Stars klassischer Medien und ihren Erfolg, dass ihnen die diesbezügliche Entscheidung, über Soziale Medien zum Beispiel etwas Privates zu verbreiten, relativ freisteht. Es stellt sich also hier die Frage, ob und warum diese Differenz insbesondere Meghan als langjähriger Schauspielerin nicht bewusst ist. Und auch nicht den Beratern der beiden. Ob hier einfach ein Missverständnis vorliegt, Medienkompetenz nicht so wirklich ausgeprägt ist, das Paradoxe ein gezieltes oder einfach hingenommenes Geschäftsmodells ist, es noch weitere Faktoren gibt, kann hier selbstverständlich nicht geklärt werden.
Das paradoxe Geschäftsmodell: Alles preisgeben und öffentlich unter der Preisgabe leiden
Berufe in den Medien benötigen zweifellos genauso eine umfassende Ausbildung wie sie Juristen und Ärzte für ihren Beruf verlangen — sei es als staatlich anerkannter Beruf oder als Studium. Und diese Berufe gibt es mittlerweile — oft in interdisziplinärer Ausrichtung zw. Praxis und Theorie, also gewusst warum und wie zugleich.
Das so viele Menschen an und für sich und Reality Stars insbesondere »einfach so« am Werk sind, liegt dran, dass diesbezüglich eine erst recht junge Tradition am Werk ist. Obschon Kommunikation natürlich wohl seit Beginn der Menschheit ein entscheidender Faktor ist, ist das Bewusstsein für sie erst jüngst etwas gewachsen und — wie der Autor dieses Blogs ja immer wieder betonen muss — nach wie vor nicht sehr ausgeprägt. Anders gesagt: Es fehlt noch am Verständnis für die Relevanz dieser Zunft und Kommunikation an sich sowie für die Notwendigkeit gegenwärtige und künftige Probleme im Zuge ganzheitlichen Denkens und Handelns zu lösen. Stattdessen sind Schubladen und eben traditionelle Berufs- und Weltbilder, der Erfahrung des Autors dieses Blogs nach, immer noch verbreitet. Und wie so häufig wird das damit legitimiert, »dass es ja so läuft« und »gut gelaufen« ist. Brüche in der Gesellschafts oder zw. Berufsgruppen sind aber nicht erst gerade das Ergebnis von einem Zuwenig an Ganzheitlichkeit und Kommunikation. Vielmehr ist es das Resultat von zuwenigen Profis der Kommunikation am Werk, zu wenig Kommunikationskompetenz allerseits.
Natürlich ist diese freie Betätigung nicht in Gänze oder grundsätzlich zu reglementieren, sollte es vielleicht auch nicht: Schließlich geht es ja durchaus auch um eine freiheitliche Betätigung. Die man — wenn auch wie gesehen regelmäßig viel Unsinn etc. (als Verschwörungstheorie zum Beispiel) seinen Platz im Netz findet — akzeptieren muss. Der Erfolg von Influencern liegt auch in Teilen daran, so die Beobachtung des Autors dieses Blogs, dass Medienkompetenz eine seltene Sache ist und damit vieles unreflektiert übernommen wird — wie gesagt dabei sollen nicht alle Influencer und ihre Methoden über einen Kamm geschoren werden (siehe oben). Und natürlich gibt es da schlicht Talent, warum es ohne Berater und Co funktioniert — mehr oder weniger verantwortungsvoll mit und ohne deren Zutun, übrigens.
Und dieses Talent bezieht sich einerseits auf gute Aufbereitung von Inhalten oder eben darauf, »was zieht«: zum Beispiel eben das Private. Dazu gehört — fragwürdigerweise auch — etwas, das man als Opfernarrativ beschreiben kann. Wobei: Der Begriff ist keine Beschuldigung von Opfern im Sinne, dass sie selbst verantwortlich sind für die ihnen entgegengebrachte Feindseligkeit anderer. Es sei nochmals betont, Hass und Mobbing sind nicht die Schuld der Peron, die sie erleben muss! Das Wort »Opfernarrativ« beschreibt eine Erzählweise/eine Erzählung, welche/s wohlwollend von der Kenntnis zur sogenannten »Heldenreise« zeugt. Die Heldenreise umfasst eine dramaturgische Struktur bzw. ein Basisgeschichte sowie eine bestimmte dazugehörige Figurenkonstellation. Sie kennt viele Varianten — eben auch die des tragischen Helden. Ein Held oder eine Heldin, der oder die ins Abenteuer gezwungen wurde, es aber dennoch wacker absolviert. Diese Reise ist uns allen vertraut — weil sie in so vielen Geschichten seit Kindheitstagen vorkommt, gar auf Grund ihres archaischen Kerns.
Was heißt das konkret? Es mündet in Sätzen wie »Das Leben in der Öffentlichkeit ist nicht einfach.« — aus der Feder/dem Mund von mit ihrer Privatheit arbeitenden Influencer und Social-Media-Stars. Manchmal auch aus dem Munde von Vertretern klassischer Medien: Filmstars (und dieses entstehen insbesondere in Deutschland regelmäßig in Kooperation mit TV-Sendern (linear und Streaming)) behaupten, sie würden das Medium nicht gut finden und auch dortige Formate nicht schauen, sie auch insbesondere ihren Kinern nicht zugänglich machen. »Warum soll man Sie und ihre Werke überhaupt unterstützen?«, muss man sich als Zuschauer dann fragen. In diesem Fall haben wir es mit einem klassischen Habitus zu tun, der zwar eine Haltung eines bestimmten Milieus widerspiegeln, Dazugehörigkeit ausdrücken soll, aber letzlich auch zeigen kann, wo Defizite in Bezug auf das Verständnis von Kom. und Medien vorliegen. Übrigens daraus resultiert auch das Beitragsbild. Aber gut.
Genereller: Man beschwert sich also über das, was die eigene Lebensgrundlage darstellt. Gut, das macht wohl jeder mal, aber hier geht es doch darüber hinaus und auch über die eventueller Aussagen von TV-Stars: Hier — im Fall von Influencern etc. — wird mehr oder minder bewusst das Motiv des tragischen Helden bedient. Weil es im Menschsein verankert ist, durch viele Blockbuster so bekannt ist, weil es Tiefe oder den Eindruck davon erzeugt vielleicht: Ein Charakter, der etwas zu erleiden hat, ruft Verbundenheit hervor.
Aber: Natürlich soll das nicht heißen, dass man sich als öffentliche oder semi-öffentliche Person alles gefallen lassen muss. Ganz im Gegenteil: Wie bereits oben gesehen sind Paparazzi oder das eventuelle Gepöbel sowie das ständige Bewertung durch Fremde bis hin zum Mobbing für alle, die es erleiden müssen inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. Für alle gelten die gleichen Bedingungen — auch was das soziale Miteinander angeht. Zumindest sollte es so sein — ja, das mag naiv sein. Medienkompetenz ist also mehr: Sie ist auch eine Schulung oder ein Nachdenken darüber, wie wir miteinander umgehen oder wir einen besseren Umgang miteinander erreichen können.
Auf Meghan und Harry bezogen meint das, dass sie sicherlich oft grausamen Angriffen von Dritten ausgesetzt sehen und es sind. Allerdings machen sie sich auch ein Narrativ zu eigen, welches auf besagt-paradoxe Weise mit ihrer auch freiwilligen Öffentlichkeit spielt. Und es erinnert sehr an das von Harrys Mutter: Sie wurde faktisch von medialen Formen — von der Yellow Press — wahnsinnig belästigt, hat aber auch im Rahmen ihrer Scheidung ihre private Situation in der königlichen Familie und in Bezug auf ihren Ehemann und dessen Geliebte mehr oder weniger bewusst öffentlich gemacht und bisweilen zu ihrem Vorteil genutzt. Wenn auch jüngste Erkenntnisse zeigen, dass sie mit Falschinformationen vom Boulevardzweig der britischen BBC quasi betrügerisch zur Preisgabe von mehr Details verleitet wurde.
Meghan und Harry verwenden — bewusst oder nicht — ein ähnliches Narrativ, obschon es ihnen ja gerade darum geht — zumindest mit Blick auf manche ihrer Aussagen —, »es« anders zu machen. Gleichsam — geradezu bzw. noch mehr paradox — tragen sie Persönliches inklusive Kinderfotos und den Streit mit seinem Bruder bzw. Schwager/der Familie Harrys in die Öffentlichkeit. Und die beiden wollen ja von der Öffentlichkeit leben, da sie sich vornehmlich als »sie selbst« vermarkten wollen. Ein Rückzug aus der Öffentlichkeit ist also nur schwerlich für sie möglich, selbst in Teilen, weil eben — wie oben behandelt — das Produkt ihrer Arbeit mit ihnen selbst übereinfällt. Ist also doch etwas Tragisches an Ihrer Situation? Weil es keine Alternative gibt; weil Fehler, mindestens Problematisches wiederholt wird? Jedenfalls: Sie wollen »mit sich selbst« »die Medien« für ihre auch wohltätigen Ziele nutzen. Leider in einer Weise, die — schon bei Diana eigentlich sichtbar werdend damals und wohl auch heute — nicht funktioniert: Einem — in Teilen — zur Entfesselung tendierenden und bisweilen negativen Flaschengeist wird die Tür (bzw. eben der Falschenverschluss) geöffnet. Einem Flaschengeist, der sich letztlich aber nicht nach Belieben abstellen lässt. Insofern ist es eine Gratwanderung, an der sich die beiden — bewusst oder nicht — versuchen. Bleibt nur, ihnen das Beste zu wünschen. ![]()