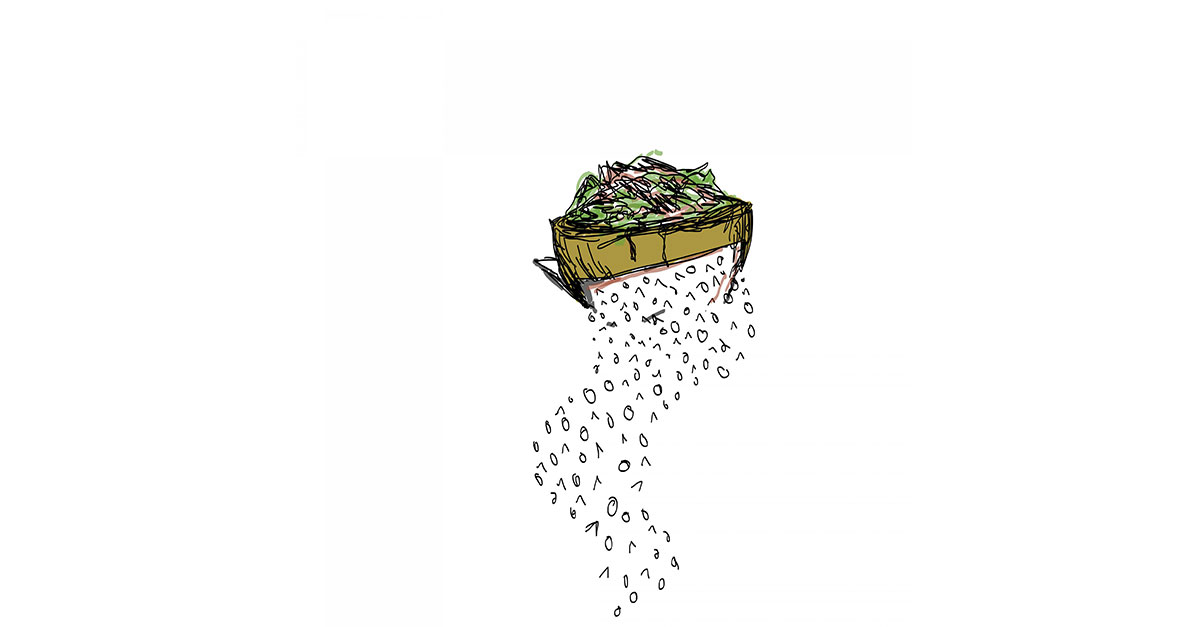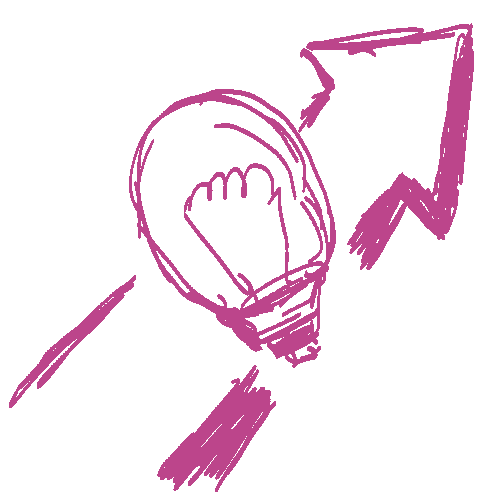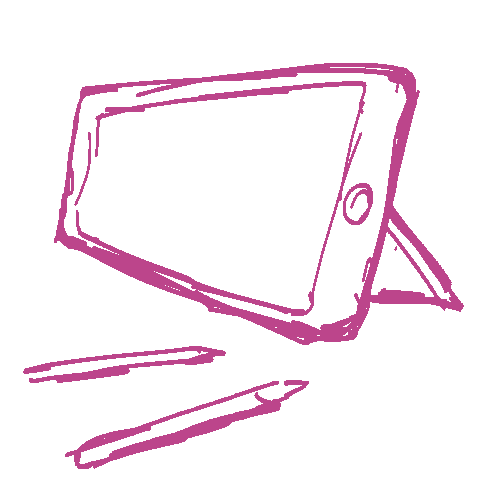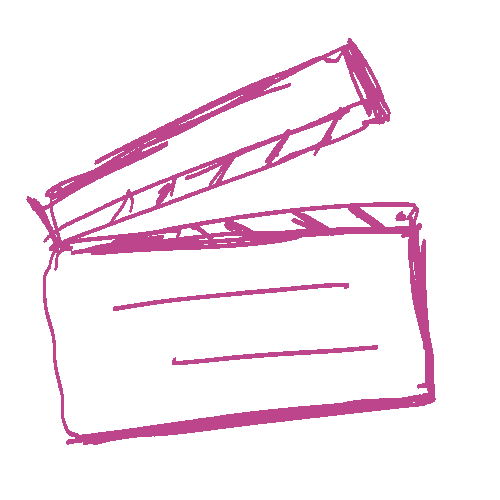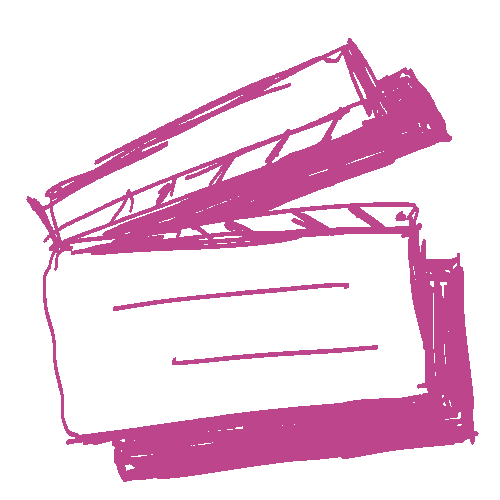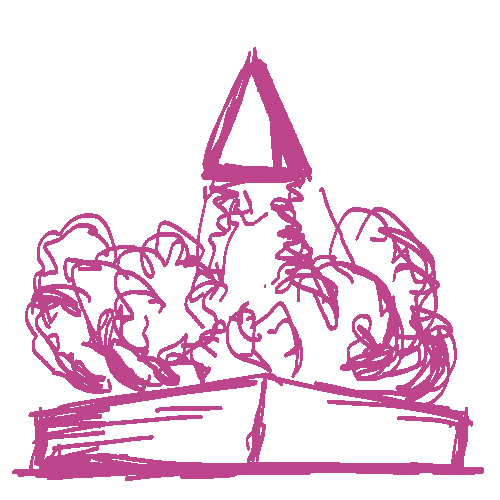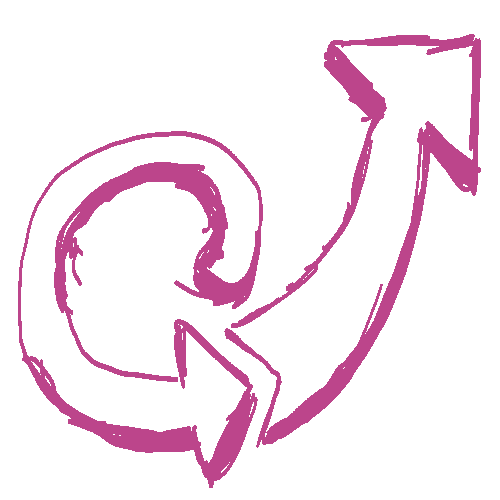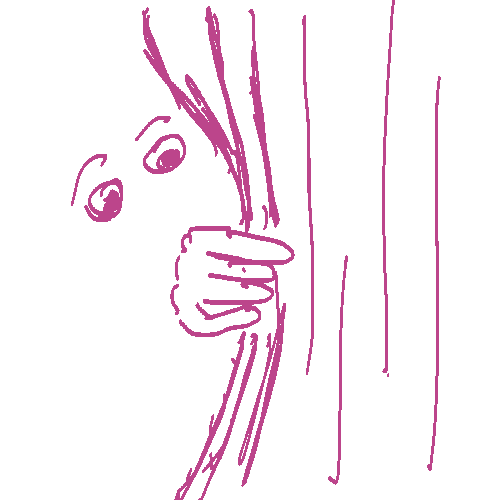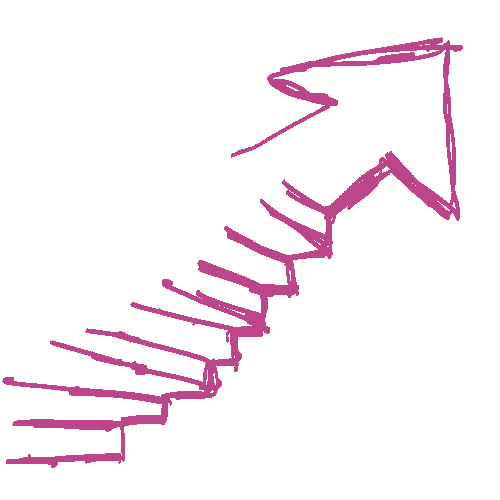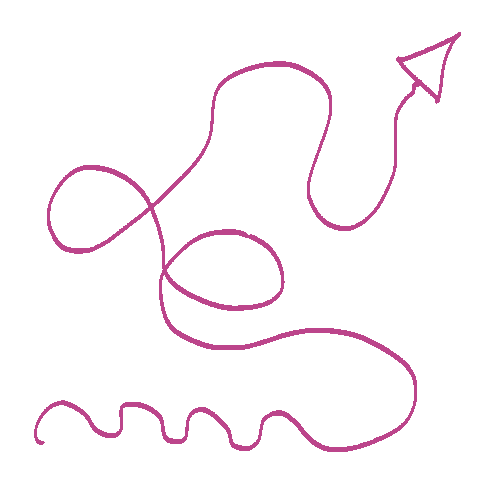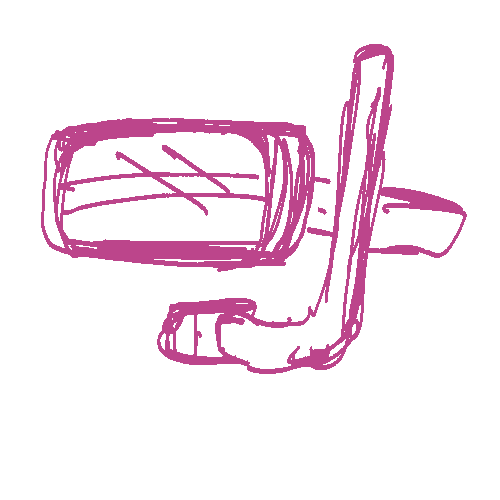Geht es Ihnen ähnlich? Digitalisierungstalks und ‑diskussionen sowie mit einem ebensolchen Attribut versehene Markenbegriffe allerseits: »digitale Motoren«, »digitales Management«, »Digitalisierung macht dick!«, »Schulen müssen digital werden, sie brauchen Tablets!« … Man fühlt sich an das allgegenwärtige »2000« kurz vor der Jahrtausendwende und oft damit verwechselt erinnert: In wessen Nachbarschaft gab es da nicht einen entsprechenden Dönerimbiss mit der Zahl als Zusatz im Namen? Vielleicht kommen bald die digitalen Döner …
Die einen wollen mit »Digitalisierung« mahnen und warnen, die anderen hipp und als Macher »mit Zukunft im Blick« rüberkommen. Politische Berater, wohl regelmäßig Kommunikation ohne fundierte oder studierte Basis an Mann und Frau bringen wollend, scheinen für den schnellen Effekt zu empfehlen, alles auf die Digitalisierung zu schieben. Wohl oft, ohne zu wissen, was der Begriff eigentlich meint oder ob er überhaupt eine Bedeutung hat und ohne die langfristige — fatale — Wirkung der Digital-Floskel zu erfassen.
Das Gesagte ist eine Vermutung, nicht mehr, nicht weniger. Aber wie sollte man sonst erklären, dass Digitalisierung zum Mantra wird? Das geschieht womöglich in der mutmaßlichen Hoffnung, Nachfragen (à la »Wie genau wird das und jenes umgesetzt?) mit dem abstrakten Begriff unwahrscheinlicher zu machen. Der Begriff lädt zwar eine, dass ein/e jede/r darüber sprechen kann, und doch strahlt er womöglich die Aura aus, dass man nicht viel zu ihm sagen sollte. Das alles mag als (kurzzeitiger) Effekt fruchtbar sein — zw. Beruhigung und Aufrütteln. Dabei wird aber eine langfristige Chance verpasst, bisherige Umbrüche zu erklären und auf absehbare Veränderungen sinnvoll vorzubereiten.
Fakt ist (und damit hinkt der Döner-Vergleich) Digitalisierung »kommt« als Ganzes nicht mehr, wie Ende der 1990er die 2000-Marke erwartet wurde. Digitalisierung kommt in weiteren Phasen/es kommen weitere Phasen von ihr. Die Anfänge sind in diversen Professionen, gar im Alltag längst vollzogen und etabliert: Digitale Videobearbeitung beispielsweise ist bisweilen mehr als 35Jahre alt und leistungsstarke, mobile Endgeräte heute quasi in jeder Hand. Die Digitalisierung wurde in Deutschland einfach, bitte verzeihen Sie die Formulierung, verpennt. Insbesondere auf staatlicher Seite ist man oft nicht mal über Anfangsphasen hinausgekommen: Haben Sie schon einmal wirklich gelungen per E‑Mail mit einer Behörde kommunizieren können? Überhaupt eine Antwort erhalten (und dann noch freundlich)?
Der Ausbau etwaige Netze ist gewiss ein schwieriges Unterfangen, da Proteste sich nur so aneinanderreihen. Nicht zuletzt, so darf vermutet werden, auch, weil über Digitalisierung so wenig bekannt ist: Weil der Begriff gerade bei älteren Menschen Angst hervorruft. Auch deshalb, weil sich krude Thesen allerseits verbreiten, sich eine Anfälligkeit dahingehend zeigt, die nicht zuletzt auch mit dem im Folgenden behandelten Mangel an Medien- und damit Digital-Kompetenz zusammenhängt. Gleichsam ist nicht alles digital, nur weil es digital ist — das Home-Office während der Corona-Welle im ersten Halbjahr 2020 hat, neben Team-Software und E‑Mail, nicht zuletzt Telefone glühen lassen. Solch Telearbeit kommt auch ganz ohne Einsen und Nullen aus bzw. war bereits vor der Digitalisierung möglich. Aber richtig, Digitalisierung wird noch viel verändern — da ist die Ersparnis an Bürofläche durch das Home-Office nur ein kleiner Vorgeschmack zur Stellungstreichung gerade in der Verwaltung …
Und damit muss die provokante Überschrift natürlich relativiert werden: Wir müssen uns mehr mit Digitalisierung beschäftigen, denn sie ist noch lange nicht am Ende bzw. abgeschlossen. Sie ist aber gleichsam mehr als ein Vierteljahrhundert im Gange, sie ist mehr als Nullen und Einsen, sie ist mehr als Technologie, denn Sie wird mehr denn je soziale Veränderungen mit-bedingen, denn wir sollten mündig mit dem allseitigen — gelinde gesagt häufig hohlen — Sprechen von Digitalisierung umgehen können. Daher ist es wichtig, mehr über Digitalisierung zu wissen. Das wird hier— dem Format »Blogbeitrag« entsprechend — nur in Teilen gelingen. Dennoch: Die These dabei ist, den abstrakten Begriff aus Perspektive von Kommunikation und Medien zu erklären. Denn oft, so die Beobachtung des Autors dieses Blogeintrags, geht es, wenn von Digitalisierung gesprochen wird, um Kommunikation (die übrigens ja immer auch soziale und technologische Aspekte berührt).
Digitalisierung? Das sind vor allem Medien, das ist Kommunikation
Wirklich? Medien? Ja, viele von dem, über das in der Digitalisierungsdebatte gestritten wird, das mit Digitalisierung bezeichnet wird, fällt eigentlich unter die Begriffe »Medien« bzw. weiterführend »Kommunikation«. Aber Vorsicht, auch der Begriff »Medien« hat eine ähnlich problematische Nutzungsgeschichte wie der der Digitalisierung. Bevor wir dazu kommen, sollte der Begriff »Medien« mit Inhalt gefüllt werden: Bücher, Filme, das Tablett, um Bücher zu rezipieren, am Unterricht teilzunehmen — all das sind Medien. Und viel davon sind heute digital: die App, das Betreibsystem auf dem Smartphone, die Datenübertragung, Bilder, Videos — alles in Einsen und Nullen zerlegt.
Oft sind diese Beispiele natürlich sehr typische Medien; es lohnt sich, »Medien« in einem weit gefassten Sinne und auf differenten Stufen zu begreifen: Luft ist ein Medium, damit akustische Informationen übertragen werden können — das klappt im Vakuum bekanntlich nicht. Der Mensch ist an sich mindestens ein Medium: Hier verhalten wir uns so, dort anders … So gesehen ist er ein mehrfaches Medium. In Urzeiten gab es oft nur das Mensch-Medium, welcher als Erzählender etwaige (für eine Gemeinschaft wichtige) Mythen, aber auch Erfahrungen oder konkretes Wissen weitergeben konnte. Bildgeschichten, Schrift oder andere Speichereinheiten waren noch nicht vorhanden. Dann ist Sprache ein Medium, insofern es ein von Konventionen bestimmtes System ist, innerhalb dessen sich die Wahrscheinlichkeit eines Austausches zumindest etwas erhöht. Jeder kennt das, spricht man nicht dieselbe Sprache, kann es schwer werden (oft hilft, dann nur der Umstand, dass man als Mensch unter Menschen doch eine partiell gemeinsame Basis besitzt).
Bild, Text und Ton sind sogenannte »Basismedien«. Dann wäre da zum Beispiel das Medium »Buch« — verschiedene Papiersorten und Formate, Layouts, Typografie, die das Werke unterstützen oder ihm Ausdruck verleihen. Oder es quasi sabotieren: Denken Sie an die schulischen Heftchen bzw. Bücher wahnsinnig kleiner Schrift. So etwas bestimmt das Erlebnis während des Lesens mit bzw. das Eintauchen in eine Geschichte. In jedem Fall geht ein distinktes Rezeption- oder besser Kommunikations-Erlebnis von diesem Medium aus. Dazu gehören bestimmte Produktions- und Vermarktungs-Strukturen — Verlage, Lektoren, Buchpreisbindung etc. Film als ein weiteres Medium ist da anders, bietet ein anderes Erlebnis usw.
Dann ist da ein konkretes Werk, durchaus auf zwei Ebenen: Bleiben wir beim Medium Buch und nehmen wir mal Goethes Faust — es ist ein Werk eines konkreten Künstlers bzw. Dichters, aus der Feder besagten Goethes: Einmal als aufwendig illustriertes Buch, einmal als digitale Datei, als E‑Book zum Beispiel kann es vorliegen.
Um Digitalisierung zu verstehen, muss man Medien bzw. Kommunikation verstehen
Wie hoffentlich bereits ersichtlich werdend: Begreift man Medien in einem weitgefassten Sinne, wird ihre Bedeutung besser offenbar, ja sogar ihre Wirkung. Und wie gleich noch weiter ersichtlich werden soll: auch die Bedeutung und Wirkung des Digitalen.
Sicherlich werden beide Begriffe — also Medien und Digitalisierung — damit nicht derart konkret, dass sie in eine oder jeweils eine Schublade passen. Das sollen Sie auch nicht — Schubladen sind, so die Erfahrung des Autors dieses Blogeintrags, nicht die Antwort auf nebulöse Begrifflichkeiten. Denn das wäre letztlich eine Verzerrung nur in die andere Richtung: Was vorher beliebig ist, wird mit Schubladen oft zu sehr in ein Korsett geschnürt. Beide Begriffe bleiben — wie im Folgenden zu sehen sein wird — also offen, sollen aber verständlicher werden.
Und nein, bitte nicht in das inflationäre »Die Medien manipulieren!« verfallen. So sehr von den Ausrufenden solcher Behauptung auch geglaubt wird, dass solch eine Manipulation allgegenwertig sei, so sehr muss dann auch jedes Gespräch an einer Bushaltestelle als Manipulation verstanden werden — etwa, wenn man jemanden von einer Meinung überzeugen will oder jemanden überreden will, die eigene zu teilen. Dann ist da zum Beispiel das Türaufhalten … Wir werden sehen, Einfluss ist da, aber angesichts vielfältiger Anbieter und der Komplexität von Kommunikation ist selbiger nicht pauschal als wirksam anzunehmen. Zudem sind Medien (nicht nur redaktionell — dazu gleich) hierzulande relativ freiheitlich und unabhängig.
Also: »Medien« meint zunächst etwas Dazwischenstehendes. Und dazu taugen auch die digitalen Hintergründe oder Erscheinungen, sprich Medien: »Einsen und Null sind heute meist immer irgendwo dazwischen!«, könnte man analog (wohlgemerkt vereinfacht) sagen. In einer verbreiteten Vorstellung steht das Digitale bzw. Mediale also »dazwischen«, während eines Transports von etwas — einem Inhalt und einer Message von A nach B.
Und diese Vorstellung — wie weit verbreitet sie auch sein mag — wollen wir gleich hinter uns lassen. Medien sind keine Container: Je Medium verändern sie die Message, je Medium nehmen die Medien Einfluss auf Empfänger und Sender gleichzeitig. Das Medium »Zug« zum Beispiel — wie gesehen Medien sind viel mehr, als meist angenommen wird, es hilft solche Beispiele zu nutzen, um Medien zu verstehen: Die Fahrt bzw. wie sie verläuft — die Sauberkeit, die Pünktlichkeit — nehmen Einfluss auf die Laune des Reisenden. Und damit nicht selten auf die, welche ihn empfangen.
Dann kann es ganz banal schlechter Empfang sein, der das Transportierte verändert — als Bildstörung, niedrige Auflösung eines Streams. Solche Veränderung kann aber auch jenseits einer rein technischen Ebene verstanden werden: Twitter nötigt kurze — manchmal zu kurze — Messages auf: der begrenzten Zeichenzahl halber. (Der Drang zur Verkürzung und Provokation angesichts einer Flut von Angeboten, einem Rauschen, ist oft über den Effekt hinaus problematisch, weil verzerrend, gar irreführend.)
Ein Buch in Printform kann mit später sentimental wirkenden Eselohren versehen werden, während ein E‑Book eine Suchfunktion hat; ein DVD bleibt recht konstant in ihrer Qualität und kommt ggf. mit Menüs daher, eine VHS-Kassette verschleißt, bis der Film kaum noch zu betrachten ist, hat aber auch diese 90er-Jahre- / Home-Video-Atmosphäre. Etwas in Text zu sagen, ist anders als mit einem Bild. Kopie für Kopie verändert sich der Inhalt und vielleicht auch die Interpretation — kennen Sie noch »Stille Post«?
Insgesamt sind Medien — quasi über ihre Eigenarten hinaus bzw. je Eigenart spezifische —Spiegel oder Abbilder der Welt. Man könnte zum Beispiel sagen, Bücher repräsentieren das menschliche Bedürfnis etwas über das individuelle Gehirn (und seine Anfälligkeit — z. B.: Verklärung der Vergangenheit) hinaus zu speichern. Und dennoch sind Medien eine auf die oder eine Welt einflussnehmende Größe. Das heißt eben auch, an ihnen kann man ablesen, wie die Welt tickt. Und ja, nicht nur Medienkonzerne betreffend, schließlich kann mittlerweile jeder weitreichend kommunizieren. Insofern ist der Hass, aber auch die »Liebe« im Internet ein Spiegelbild gesellschaftlicher oder weltweiter Befindlichkeiten. Und natürlich — wie gesagt in einem Wechselspiel — sind Medien Einflussgrößen: Das oft anonyme Internet kann der Meinungsfreiheit im positiven Sinne dienen, aber auch Hass und Populismus begünstigen — beides aber nicht pauschal verursachen. Übrigens fürchtete schon in der Antike Platon — also lang bevor man sich über (digitale) Medien aufregte —, dass mit der Schrift die Menschen quasi dummer werden würden, da sie ihr Gedächtnis weniger nutzen müssten. Das kommt bekannt vor, oder? Heute eben anderen Ebenen entgegengebracht.
Gerade die Schattenseiten des Netzes sind ein beliebter Sündenbock, um vom eigentlichen Problem abzulenken — nämlich einer Anfälligkeit vieler Menschen gegenüber einer (durch aus der ganzen Welt berichtenden Medien, durch die zu Produzenten gewordenen Individuen) ganz oder zu nah oder übermannend empfundenen Welt bzw. der geringen Medien- und Weltkompetenz, um diese Flut zu handhaben. Oder allgemeiner: Mit dem Sündenbock wird das asoziale Bedürfnis vieler Menchen, sich über die Abwertung anderer zu profilieren, ignoriert.
Hier berührt das Ganze eben auch soziale Komponenten: Medien verbinden und trennen bzw. Digitalisierung tut das — weil man die Meinung der Autoren dort nicht teilt, weil man das Abo nicht hat. (Vor-digitale, digitale) Massenmedien erreichen große Publika und schaffen vielleicht ein gemeinsames Themenfeld über viele Menschen und Gruppen hinweg. (Digitale) Medien werden dann kleinteiliger und erlauben, einst in dieser Masse übersehenen Gruppen und Individuen, sich auszudrücken. Bzw.: Sie lassen sch als Zielgruppe ansprechen. Gerade digitale Technik macht uns ja in vielerlei Hinsicht ohne großen Aufwand zu Kommunikatoren — im Sinne, dass wir selbst Aufwendiges wie Druckerpressen und Funkmasten nicht benötigen. Die Postkutsche wird nach dem Postauto dann schließlich durch digitale Techniken wie E‑Mail oder eine Whatsapp ersetzt, wie Softwarelösungen womöglich Einschnitte hinsichtlich der Stellenzahlen in der Verwaltung bedeuten können. Das Mobbing auf dem Schulhof wird ins Internet erweitert, verlagert oder erhält eine neue Dimension. Menschen, die ich früher wohl nie wieder gesehen hätten, können über tausende von Kilometer in Kontakt miteinander bleiben, sich gar via Video eben mal sehen usw. Was dann vielleicht auch eher begünstigt, weiter zu reisen, entfernte Stellen anzunehmen etc. All das ist gewiss ambivalent. Gerade Mobbing etc. sollte gewiss nicht hingenommen werden, gleichsam wäre es — das wissen Sie alle — anzunehmen, es könnte abgestellt werden. Medienkompetenz ist also auch ein reflektieren darüber, wie wir miteinander (besser) umgehen können.
Insgesamt ist Kommunikation und sind Medien wie Netzwerke zu verstehen. Wir sind an ihnen immer als Produzent und Sender gleichermaßen beteiligt, selbst in der »bloßen« Rezeption: Wir müssen ja das Medium bzw. Werk interpretieren — dabei kann die Message auch ganz anders gedeutet werden denn ursprünglich gedacht. Das Werk kann sich sogar dem Urheber entziehen — ein Film wird nicht selten ganz anders, als ihn sich die Macher vorgestellt haben. Vieles verläuft anders, gewinnt ein Eigenleben. Heute können wir in Online-Welten virtuell bis faktisch eintauchen (fiktive Währungen, die mit realer in einem Wechselkurs stehen z. B.) — werden Teil einer Welt, die von vielen (realen/virtuellen) Personen beeinflusst wird.
Grundsätzlich ist das Erleben von Medien meist ein mehr oder minder gemeinsames — zusammen mit anderen Rezipienten, den fiktiven Figuren, den Autoren: Wenn wir einen Roman betreten, geschieht dies quasi wie am Rand eines Pools sitzend: Mal mehr oder weniger im Hinterkopf, dass es nicht in Gänze real ist, was wir lesen. Dann aber tauchen wir partiell ein: Wir lassen uns auf die Geschichte ein, wenn sie uns denn gefällt. Wir interpretieren das Werk eines/einer anderen, machen es zu unserem eigenen; wir sprechen im Unterricht darüber, mit Freunden usw. und ko-kreieren oder verändern es weiter … Und das gilt nicht nur für Bücher — das Klischee, Bücher regten pauschal mehr Fantasie an denn andere Medien, ist mit Blick auf die sogenannte Immersion stark zu bezweifeln. Das Büro wird vom Chef/der Chefin bestimmt, aber Sie als dort arbeitende Person nehmen auch Einfluss auf die Arbeitssituation — zumindest in gewissen Maßen.
Insofern stehen Medien nicht nur zwischen uns, sondern wir befinden uns auch in ihnen. Das Viertel prägt uns, wir prägen das Viertel. Die Software grenzt bisweilen die Möglichkeit unserer Gestaltung ein, wir geben Feedback an die Hersteller. Medien sind wie eine Flüssigkeit, in der man sich zeitweise, mal mehr oder weniger real, virtuell etc. befindet. Obacht: Diese Flüssigkeitsanalogie ist eingängig, aber sie ist bitte nicht zu wörtlich zu nehmen — oft genug sind einfache Bilder hilfreich, aber nur als ein einen Einstieg bietendes Tool. Und so soll auch dieses Bild hier verstanden werden.
Damit ist erfolgreiche Kommunikation sehr unwahrscheinlich — weil man sie nicht versteht, die Geschichte einen nicht anspricht, das Design durchfällt, die Message einem missfällt (sie also ignoriert wird), weil es so viele andere Angebote oder Blinkendes gibt … Oh, ein Katzenvideo!
Wir können von Medien also übermannt werden, aber nicht unbedingt … Auch darum scheitern trotz groß angelegter Datenerfassung Filme, Werbekampagnen und die damit zusammenhängenden Produkte. Das heißt nicht, es gibt keine Verantwortung bei professioneller Kommunikatoren, es mahnt die Verantwortung aller an: fundierte Recherche, eigenständiges Informieren auch des Publikums — da es in heutiger Zeit immer wieder selbst zum Produzierenden wird, hat es partiell eine ähnliche Verantwortung wie Profis usw. Damit sind Begriffe wie Sender und Empfänger meist rein theoretische Konzepte.
Die Digitalisierung macht/tut Die Medien
machen/tun — auch nicht besser
Mit den bisherigen Ausführungen im Hinterkopf verlieren viele bekannte medien- und damit auch digitalisierungs-bezogene Aussagen an Gültigkeit. Da es aber hier darum geht, problematische Begriffsaufweichungen zu behandeln, sollten wir darauf eingehen, was quasi regelmäßig über Medien und mittlerweile die Digitalisierung gesagt wird: »Die Medien tun/machen / Digitalisierung tut/macht…«, »Medien machen dick.« »Die neuen Medien« — um nur einige Stilblüten zu nennen.
Die Medien können sicherlich eine gewisse Selbständigkeit erreicht — das kennt jeder, der sich mal als Heimwerker versucht hat: Da kann das Projekt, das man kreiert hat, sich durchaus verselbständigen, einem als Urheber quasi etwas aufzwingen. Gemeint sind mit dem Ausruf eher populistischer, mindestens vereinfachender, oft eben den inflationären Gebrauch des Begriffs nicht wirklich verstehender Sprecher redaktionelle Medien. Übersehen wird im Ausruf, dass es sich bei diesen bzw. »den Medien« nicht um eine einzelne Person handelt, sondern um zahlreiche Individuen, die auch Teil der Gesellschaft sind, über welche sie sich so oder so äußern. Natürlich sind da auch wirtschaftliche Interessen anzutreffen, genauso ist da in professionellen Branchen eine Art Kodex zur Aufklärung vorhanden. Es mag jene, die Vereinfachung herausrufen, überraschen: Ja, auch Kommunikatoren auf sozialen Medien sind Medienmacher — da ist es gelinde gesagt paradox, wenn solche Personen über »die Medien« schimpfen oder ein YouTuber (≈ ein Medienstar) mit polemischen und provokanten Video-Titeln oder ‑Inhalten »Medien« angreift oder in Teilen zurecht kritisiert, es denn Kritisierten aber letztlich in vielerlei Hinsicht gleichtut.
Bei solchen Zuschreibungen werden Medien regelmäßig zu einer Projektionsfläche — im guten oder schlechten Sinne: »Sie machen aggressiv!« in Bezug auf Computerspiele oder um die Jahrtausendwende hinsichtlich des noch relativ jung-etablierten Internets: »Medium der Demokratie«. Nur am Rande, beides ist so pauschal nicht haltbar: Medien machen nicht einfach aggressiv, selbst bei Gewaltdarstellungen (und deren Interaktion); insbesondere nicht pauschal, wenn der oder die Einzelne nicht vorbelastet ist. Auch zeigte sich für fundiert Beobachtende bereits in den sogenannten Nullerjahren, dass das Netz nicht nur in einer positiven Weise demokratisch ist — Stichworte »Betrügereien«, frühe Hetze usw.
Heute sind wir mit ganz anderen Dimensionen von Hetze und Populismus konfrontiert. Das macht das Internet natürlich nicht umgekehrt pauschal schlecht. Nüchtern betrachtet ist es ein Spiegel wie oben beschrieben. Ein Spiegel, der auch zeigt, dass es mit dem Verständnis von Medien und damit auch Digitalisierung oder besser Kommunikation nicht immer weit her ist: etwa auch die Verantwortung anderen Gegenüber, sie nicht maßlos zu beleidigen zum Beispiel oder nicht immer mit zwei Maßen zu agieren (also nicht immer anderen antun, was man selbst nicht angetan bekommen möchte).
Nachgeordnet vielleicht sollen mit »Medien« noch Buch, Film etc. gemeint sein. Wie gesehen ist es sinnvoll, den Medienbegriff etwa größer anzulegen. Dann bräuchte es auch nicht einen Begriff wie »Neue Medien«: Diese sind ja schließlich bisweilen 25 Jahre alt. Klar, der Begriff ist etabliert, da kann man nicht mehr viel dran machen. Auch an andere Stelle wird ja entsprechend verfahren: In der Geisteswissenschaft löst ein Post-Zeitalter das andere ab. Nichtsdestotrotz sollte man wissen, dass auch diese Wortschöpfung problematisch ist. Neben dem Verfallsdatum des Begriffs »neu« (Was sind dann noch neuere Formen? »Neuere neue Medien«?), sind Internet etc. ja oft Medien in einem eher abstrakten Sinne. Schubladen wie Buch, Film, Internet funktionieren nicht nebeneinander oder nur sehr bedingt, weil das Internet eher ein übergeordnetes bzw. umfassendes System ist: Es besteht nämlich aus Text, Bild, Ton, Video (welche wiederrum aus verschiedenen Basismedien besteht) … Stichwort »Medienkompetenz«: »Neu« übt natürlich eine Anziehung auf uns Menschen aus, so sind wir Menschen eben, gleichsam können wir nachdenken: Was also im Marketing sinnvoll erscheint, ist es nicht überall … Und stets zu machen, was schon funktioniert, führt meist nicht zu Innovationen.
Das Medium Digitalisierung
Ja, das ist sie: Die Diskussionen um und das Begriffsverständnisse von Digitalisierung sind wie Medien, Räume, Spielfelder usw. Stellen wir uns vereinfach noch einmal ein Medium wie eine Flüssigkeit vor — wie gesagt, ohne solch ein Bild zum Standard zu machen. Jedenfalls befinden wir uns in den verschiedenen Sphären unseres Alltages mal mehr oder weniger in diesen medialen bzw. digitalen Milieus. Digitalisierung als eine Art Petrischale, als Vielzahl solcher Gefäße: Darin und dadurch entsteht etwas. Aber was »da drin« ist, bestimmt den Ausgang ebenfalls mit — also wir als Menschen zum Beispiel, gesellschaftliche oder kulturelle Faktoren, genauso Technisches, Wirtschaftliches, die Umwelt etc.
Ähnlich wie oben für Medien beschrieben ist dann eher von einer netzwerkartigen Konstellation auszugehen: D. h., es ist nicht immer von einer Abfolge zu sprechen, sondern von komplexen Prozessen, bei denen nicht immer ein Anfang und ein Ende bestimmbar sind. Technik macht etwas möglich, Bedürfnisse erschaffen Technik usw., Dinge werden umgewidmet, zufällig entsteht etwas … Wie einleitend gesagt ist das nicht ganz neu bzw. nicht erst mit der Digitalisierung so.
Und natürlich geht es bei Digitalisierung regelmäßig um digitale Medien oder Verfahren: Filme, Smartphones, Audiobücher, ja sogar Gedrucktes wird im Produktions- oder Rezeptionsprozess regelmäßig irgendwann in Einsen und Nullen zerlegt, ist in dieser Form verarbeitet, manchmal derart übertragen worden. Wie ebenfalls einleitend gesagt ist auch das nicht ganz neu bzw. Digitalisierung teilweise schon recht alt: Auf professioneller Ebene sind Teile technologischer Digitalisierung vor mehr als 30 Jahren vollzogen worden — etwa in künstlerisch- bzw. design-technischen Branchen. Und natürlich ist das alles weiterhin im Fortgang: Die beliebte Software Photoshop hat sich rasant weiterentwickelt — softwaregestütztes Maskieren etwa ist in den letzten 15 Jahren stark automatisiert worden, was die Arbeit von Profis erleichtert. Und die Software natürlich auch im Semi-Pro oder Amateur-Bereich attraktiv macht. Unabhängig von solch einer Prämiumsoftware geschieht dies auch mit Software ähnlicher Funktionen über Apps auf leistungsstarken, nicht zuletzt mobilen Endgeräten.
Übrigens ist dies ein zwiespältiger Umstand: Gestaltung wird einerseits — positiv bewertbar — weiter zugänglich: Damit wird künstlerischer und individueller Ausgleich bzw. werden entsprechende Ausdruckformen von immer mehr Menschen realisierbar bzw. für sie erreichbar. Das hilft als Ventil oder macht Spaß. Gleichsam verbreitet sich dabei eine gewisse Unprofession in Form von Design-Baukästen sowie Vorlagensystemen. Ihnen fehlt es oft an einem konzeptionellen, auf den konkreten Sachverhalt bezogenen Fundament. Das nur am Rande.
Digitalisierung ≈ alle bleibt, wie es ist! Oder ändert sich doch alles?
Kommen wir konkret zur Digitalisierung: Die Diskussion über Digitalisierung bewegt sich zw. »Digitalisierung als Heilsbringer« und »Digitalisierung als Sündenbock«. Hier haben wir es also mit einem Gebrauch des Begriffes zu tun, der der oben angerissenen Projektionsfläche ähnelt. Digitalisierung ist bzw. die Diskussion um sie ist eine Art Medium. Digitalisierung wird somit zunächst als solche genutzt: »Die Digitalisierung wird vieles verändern!« »Mit Digitalisierung verfällt alles!«
Wie immer bei Projektionsfläche — nehmen wir mal die Übertragung von Licht aus einem Beamer oder Projektor auf eine Wand, eine Leinwand — ist das dort Sichtbare eine Art Illusion. Das macht es nicht pauschal unreal — das dort Abgebildete kann Realem folgen, es kann sogar quasi betreten werden — als Eintauchen oder Mitfiebern. Das nennt man Immersion. In diesem Beispiel nehmen Diskussionsteilnehmer regelmäßig die Position des Projektors ein.
Worauf dieses Beispiel abzielt? Die Illusion bleibt ungreifbar oder abstrakt, ist eine entsprechende Wunsch- oder Angstvorstellung. Abstraktes ist nichts Schlechtes — offen für Interpretation kann die Abstraktion gerade in künstlerischen Projekten viel Kraft entfalten, zur Diskussion anregen. Allerdings kann es auch passieren, dass ein Begriff in großer Abstraktion hohl wird, mindestens unverstanden bleibt. Und so wird Digitalisierung entsprechend den Beispielen zu einem Sündenbock oder einem Lösungsversprechen: »Probleme? Digitalisierung wird das ändern!« Aha, wie genau – das bleibt bei solchen Hülsen natürlich ausgeklammert. Und dennoch kann so eine Form von kurzzeitiger Beruhigung erreicht werden … Das mag, wie oben bereits gesehen, für den Moment gut sein, aber dadurch — durch dieses Nicht-Auseinandersetzen — werden tatsächliche Veränderungen eher unvorbereitet »einbrechend« und damit als gewaltiger wahrgenommen, als sie sind.
Digitalisierung bewegt sich in einem Spannungsfeld, welches von zwei Größen bestimmt wird: »Alles ändert sich« und »Alles bleibt wie es ist«. Was heißt das? Nehmen wir das Beispiel schulischen Unterrichts via Tablett, sagen wir mit dem Thema »Goethes Faust«: Das Tablett als Buch und Heft benutzt verändert zunächst nicht wirklich etwas Gravierendes — das Buch wird als digitaler Text basierend auf dem Original von Goethe gelesen: Mehr oder weniger, Sie alle kennen das. Hausaufgabe werden dazu geschrieben — auf der eingeblendeten Tastatur oder ggf. einer habtisch-realen. Das ist in vielerlei Hinsicht wie vor 100 Jahren. Und das muss nicht unbedingt schlecht sein – denn so wird sich sicherlich ganz solide mit dem Werk des Dichters auseinandergesetzt.
Wir können und wollen hier nicht über die Relevanz oder Nicht-Relevanz von Faust debattieren. Auch die Transferleistung erreicht durch die Faust-Behandlung ist schwer abzuwägen — also, ob man aus den Themen des Werkes etwas für’s Leben lernen kann, aus der Dramaturgie etwas für Medien- oder die Weltkompetenz ableiten kann (im Sinne von: die Welt und die dort oft zu findende Aktstruktur besser verstehen). Darauf ist später noch zurückzukommen. Was aber diskutiert werden muss, ist, ob im skizzierten Szenario Tablett etc. wirklich nötig sind? Wäre es nicht zumindest in Teilen, als Lehreinheit, weiterhin sinnvoll, das Schreiben per Stift auch mal zu trainieren? Und sollten gleichzeitig bzw. vor allem digitale Medien nicht vielleicht besser ihren Eigenarten entsprechend genutzt werden?
Letzteres soll heißen, es bedarf zum Beispiel einer mediengerechten Ausgabe von Faust. Nicht einfach digitaler Text, sondern ein interaktiver Band, in welchem sich zum Beispiel ad hoc, in der konkreten Zeile, bezogen auf die konkrete Zeile Anmerkungen einblenden ließen, vielleicht sogar Kommentare wissenschaftlicher Natur. Statt wie früher zu Blättern, aus dem (immersiven Lese-) Flow zu geraten. Nach jedem Abschnitt bzw. jeder Szene könnte es — natürlich nicht nur im digitalen Buch selbst, sondern auch auf einer Lernplattform, betreut durch Lehrende bzw. Dozierende — interaktive Einheiten geben, um das Wissen abzuprüfen bzw. wichtiger, es zu festigen. Nach dem didaktisch sinnvollen Multimediaprinzip könnten diese Aufgaben auf diversen Ebenen die Sinne ansprechen und damit Wissen besser festigen und die Motivation der Schülerschaft aufrechterhalten. Genauso können Tabletts etc. — soweit jeder Schüler darüber verfügt — dazu dienen, den digitalen Möglichkeiten entsprechende Arbeiten zu realisieren: Die Schüler erschaffen ein gemeinsames Wiki, sie erstellen Bilder und Videos, in denen sie Erkenntnisse oder Textteile interpretieren oder ausdrücken. Das erstellte Wissen kann final in ein gemeinsames Dokument übertragen werden, um über das Schuljahr hinaus abrufbar zu sein.
Die klassische textliche Auseinandersetzung — ob nun via klassischer oder digitaler Medien — mit Faust ist damit nicht schlecht oder abzustellen, sondern eben (bezüglich anderer Kompetenzen (Schreiben per analogen Stift, sich rein textlich ausdrücken)) ein mögliches Potential von Lehre. Mit (digitalen) Medien werden die Möglichkeiten schlicht größer.
Das kann Transferleistungen, gar Interdisziplinaritäten begünstigen. Es ist — dazu später mehr — die Überzeugung des Autors dieses Textes, dass die heutige Zeit mehr denn je übergreifende Grundfähigkeiten allerseits erfordert. Und dies kann über den beschriebenen Sachverhalt hinaus idealerweise in einem gesonderten Fach gelingen, im Fach »Kommunikation«. Denn um das oben Genannte zu erreichen und zu nutzen, müssen Lehrende und Schülerschaft ganz generell im Medienverständnis und damit auch in Sachen Digitalisierung geschult werden. Auch wenn der Glaube verbreitet ist, Medien bzw. Digitalisierung sei wie das Atmen: Jeder könne es. Die Erfahrung lehrt anderes: Es braucht Profis, die diese Fähigkeiten an die Profis des Unterrichtens vermitteln.
Natürlich erfolgte die erste Beschreibung von »Tablet vs. Buch« eher verkürzt. Vermeintlich mag sich nichts ändern, in Nuancen durchaus: Das Buch erlaubt Eselsohren, benötigt kein Strom, bekommt eine Patina, die von Gebrauch oder beliebten Stellen kündet — das kann etwas Vertrautes hervorrufen, etwas Nostalgisches. Die Printform hat also eine bestimmtes Rezeptionserlebens oder kann eine bestimmte Erfahrung begünstigen. Das Tablet nun ist oft künstlich anmutend, selbst als E‑Book-Reader schwer (wobei sich Derartiges mit digitalen Papierformen wohl alsbald auch ausgleichen wird). Es braucht Strom, die Festplatte macht einzelne Bücher kurzweiliger — in Sinne löschbarer Datensätze. Dann bleibt das Buch dort theoretisch relativ unverschlissen erhalten, dann lassen sich Dinge dort besser finden — Suchfunktionen usw. Hier geht es also nicht um gut oder schlecht, sondern einfach um unterschiedliche Eigenarten.
Hier zeigt sich etwa, das mit »virtuell« mehr oder minder digitales besser beschrieben werden kann: Goethe zu rezipieren ist — wenn das Werk einem gefällt, wenn man sich darauf einlässt — wie ein Eintauchen (≈ Immersion) in einem mehr oder minder virtuellen Raum. Virtuell meint letzlich etwas nur bedingt Greifbares, etwas, das nicht so ganz real ist: Das Gespräch über ein Telefon — man bedinfdet sich in zwei Räumen und dann in einem virtuellen Miteinanders zum Beispiel etwaige Erinnerungen betreffend. In einem Spiel sind wir in einer Welt virtueller und dabei grafischer Natur. Einer Welt, die sogar von mehreren Menschen betreten werden kann. Die Fans einer Band teilen eine virtuelle, teilweise reale und fiktive Welten übergreifender Räume — Fandom ist ihnen gemein: als Ansicht, als Treffen. Das Betreten eines Buches ist das Eintauchen in einem virtuellen Raum, der einerseits auf den Vorgaben der Autoren basiert und andererseits durch jeden Lesenden individuell ko-kreiert wird usw.
Wir haben es also oft, wenn von digital gesprochen wird, mit Virtuellem zu tun — zw. realem Raum und imaginierten, zw. real und fiktiv . Insgesamt alles Formen von Mixed Reality. Und innerhalb dieser medienartigen Räume: Mediales, das sich technisch verändert, bzw. die Räume selbst haben sich verändert. Und damit zweifellos auch die Art und Weise — obschon Grundlegendes dennoch im Kern »nur« variiert wird. Digital ist also natürlich kein gänzlich belangloser Begriff, aber er überlagert Wesentliches: Frühe Formen der Bildtelefonie gab es bereits seit den 1930er Jahren …
Insgesamt ließen sich hier viele weitere Beispiele anführen: So bringt es nichts, die Verwaltung auf Computer umzustellen, wenn die Mitarbeitenden nicht tippen lernen. Zum Beispiel eine Parkrempler mehrere Stunden braucht, weil das Protokoll derart lange benötigt, um verschriftlicht zu werden. Da wird auch die Umstellung auf Flachbildschirme nicht unbedingt etwas verändern. Wir könnten noch allgemeiner herangehen: Was nutzt Digitalisierung, wenn das Büro in der Behörde wie ein privates Wohnzimmer aussieht, dem Besuchenden keinerlei Höflichkeit entgegengebracht oder ein Sitzplatz angeboten wird? Man ohnehin immer vor Ort erscheinen muss?
Digitalisierung als Spiegel? Bitte nicht in Gänze …
Verschiedene Medien erfordern unterschiedliche Fähigkeiten, sie bieten unterschiedliche Erlebnisse und Erkenntnisse — und damit auch die diversen digitalen Formen. Viel allgemeiner zeigt sich hier ein Problem, welches auf einem oben für Medien bereits skizzierten Merkmal basiert: Medien, oder wir könnten gleich sagen, Digitalisierung ist Spiegel der Welt und gleichsam auf die Welt einflussnehmende Größe. Insofern ist die Digitalisierung und sogar die entsprechende Debatte ein Spiegel der Welt: Digitalisierung ist irgendwas zw. Sündenbock und Heilsbringer (siehe oben) anzusiedeln.
Aber leider auch in einem weniger philosophisch-anschaulichen Verständnis: Vieles von Digitalisierung — gerade im Zuge der Corona-Krise — tendiert wirklich zu einer Spiegelung: Die reale Welt wird in eine digitale übertragen: Das zeigt etwa die Home-Office-Debatte. Der Arbeitsalltag soll in die heimischen vier Wände verlagert werden, bisweilen also soll das eine durch das andere ersetzt werden.
Was in dieser Debatte natürlich — medien- oder digitalisierungs-spezifisch — übersehen wird, ist, dass das Home-Office nur in bestimmten Berufen durchgehend funktioniert — wohl insbesondere in Verwaltungsangelegenheiten. Übersehen wird dabei, dass sich hier eine Vorstufe sozialer bzw. wirtschaftlicher Umbrüche im Zuge der Digitalisierung ankündigt, sich diese ggf. durch das Home-Office nur kurzzeitig verzögert (Ersparnis von Büroflächen) oder umgekhrt sogar beschleunigt (wiel bereits jetzt die Effizienz überdeutlich wird): Software-Lösungen werden viele Verwaltungsaufgaben alsbald übernehmen — bereits jetzt, das kennt jeder, der Banking bzw. Überweisungen durch abfotografierte Rechnungen betreibt, können Programme mit zahlreichen Dokumenten zurechtkommen.
Vereinzelte Aussagen, dass sich die Produktivität in der Heimarbeit steigert, sind mit Vorsicht zu genießen: Klar, das kann klappen, denn oft wird die Arbeitsatmosphäre im Büro, manchmal auch durch eine traditionell-unhinterfragte Steifheit am Arbeitsplatz, nicht unbedingt gefördert. Oder umgekehrt durch zu viele Ablenkungen gestört — es kann eben nicht jeder sein ideales Szenario zum optimalen Arbeiten im Büro finden.
Allerdings ist die Testphase des Home-Office im Zuge von Corona wenig aussagekräftig — weil sie den Charakter einer Ausnahme mit sich trug/trägt. Und dieses Wissen im Hinterkopf auch auf die Arbeitsatmosphäre Einfluss genommen hat. Dann stellt die Länge dieses »Tests« noch keine solide Basis dar, um daraus Aussage abzuleiten. Aus Erfahrung des Autors dieses Blogbeitrags — in Bezug auf seine Doktorarbeit — ist das langfristige Arbeiten aus den eigenen vier Wänden heraus oft sehr anstrengend: Weil man die eigene Räume kaum verlässt und die für die eigene Gesundheit, mindestens die für das eigene Wohlbefinden wichtige Trennung von Arbeit und übrigen Leben stetig unterwandert. Hier gibt es zweifelslos Forschungsbedarf. Diese Bemerkung muss damit als Anmerkung stehen gelassen werden.
Sehr wahrscheinlich ist es aber aus der Erfahrung des Autors dieses Blogs heraus ein Irrtum, zu glauben, dass die Videokonferenz ein reales Zusammenkommen ersetzen kann. Auch diesbezüglich werden in den aktuellen Debatten zw. Medienformen allzu oft keine Unterschiede gemacht. »Welche Medien?«, fragen Sie? Das Medium »realer Konferenzraum« oder »kreative Meetings« gegenüber »Videokonferenzen« via Skype, Zoom, Facetime, Cisco Webex, Microsoft Teams etc. Klar, oft handelt es sich nicht mehr um einfache Videotelefonie, sondern Slides und Daten können gemeinsam betrachtet und ad hoc geteilt werden, ein Chat läuft parallel etc.
Aber Methoden wie »Design Thinking« etc. lehren, kreativer Austausch entsteht durch viel mehr als den Kopf des Gegenübers zu sehen oder deren/dessen Stimme zu hören. Bedenken Sie, bis zu 80% von Kommunikation sind nonverbal. Zwar werden via Videoschalte — je nach Bandbreite und die ist bekanntlich nicht immer gut (Da muss tatsächlich direkt was in Sachen »Digitalisierung« geschehen) — Gesichter und Körper erkennbar, aber nur sehr ausschnitthaft. Erfahrungsgemäß taugt die Konferenzschalte daher nur sehr bedingt für kreative Prozesse. Besser funktioniert sie für Abstimmungen, wenn Parameter bereits geklärt sind, es um »Weiteres« geht. Wobei die Grenze zur Telefonkonferenz allerdings alsbald berührt wird. Übrigens: »Kreativ« meint hier nicht nur Kunst, Design oder Werbeagentur, sondern Produktentwicklung, Kundenbetreuung, Projektmanagement, Employer Branding, gar allgemeiner: Problemlösungen usw.
Alles in allem: Wenn auch (digitale) Medien wie alle Medien ein Spiegel der Welt sind und in diesem Fall Auskunft über den Stand von Medien‑, Digitalkompetenz und sozialem Miteinander liefern: Sie sollten nicht wie ein Kopierer genutzt werden: Nicht einfach die reale Welt in die digitale übertragen!
Erstmal gelingt dies ohnehin nur in Teilen, weil das Medium wie hier mehrfach gezeigt natürlich immer das »Transportierte« beeinflusst. Anderseits sollte es nicht geschehen, weil es schlicht unsinnig ist. Es ist nämlich eine Frage der Verantwortung: Wenn man schon eine ganze Welt, Welten in digitaler, bisweilen virtueller Form schafft, dann doch bitte, ohne die Fehler der realen Welt alle samt zu wiederholen, oder?
Das Fach »Kommunikation« — für mehr Digitalkompetenz
Bevor Digitalisierung ohne notwendiges Wissen, ohne entsprechende Fähigkeiten weiter voranschreitet, bedarf es der Gegenmaßnahmen. Warum? Kommunikation und Medien prägten immer schon die Welt — wie gesehen, ohne Kommunikation geht nichts. Auch nicht das Lesen dieses Textes, denn dafür musste das Lesen erstmal erlernet werden, in einer Serie von Lehreinheiten zum Beispiel. Dann weil Kommunikation neben Medien und Digitalisierung viele weitere Dinge umfasst bzw. einschließt: Kommunikation ist ein Werttreiber — denken Sie an das Unternehmen mit dem angebissenen Apfel: Es verkauft nicht die besten Computer, aber ein Lebensgefühl zwischen Herausstechen und idealer Usability etc. Digitalisierung ist ein Werttreiber — effiziente Planung, Kommunikation auf div. Ebenen etc. Und nicht zuletzt ist Geld ein Medium, welches nicht erst seit der Corona-Krise immer digitaler wird (≈ Kartenzahlung). Kommunikation als Design und Kunst — auch in digitaler Form, mithilfe digitaler Technik realisiert — kann (hoch-)kulturelle Relevanz entfalten. Gleichsam wird auch digital Erstelltes von digital-unabhängiger Dramaturgie durchzogen.
Insofern haben alte Dramen viel mit unserem Alltag zu tun — nicht zuletzt, weil sich singuläre als auch serielle Narrative über Medien wie TV-Serien und Bücher hinaus beispielsweise im mittlerweile standardisierten Einkauf im Supermarkt beobachten lassen: Franchises, die mit ihrer kettenspezifischen »Erzählung« u. a. im Corporate Design allerseits eine Verlässlichkeit bzw. eine den kommerziellen Erfolg begünstigende Zugänglichkeit erreichen wollen; die »Geschichte« vom selbstständigen Einräumen der Ware in den Wagen, dem Gehen zur Kasse; die dortige invitatio ad offerendum ≈ nicht der Supermarkt gibt ein Angebot ab, sondern wir, wenn wir an der Kasse zum Kauf willig sind … Neben der Notwendigkeit, wirtschaftliche Facetten und narrative Strukturen der realen Welt zu erkunden, gilt es, gerade im digitalen Zeitalter, hinter die Kulissen zu schauen, also auch etwas über Informatik zu erfahren.
Alles in allem soll das Fach »Kommunikation« zusammenbringen, was zusammengehört: Transferleistungen sind quasi Ziel jedes schulischen Faches — das an Beispielen erläuterte Wissen und entsprechende Fähigkeiten sollen von den Unterrichteten später mal auf andere Dinge angewandt werden. Das Problem dabei: Oft sind konkrete Beispiele zu spezifisch, sodass man nur schwer erkennen kann, wie sie auf andere Sachverhalte anzuwenden sind.
Das Fach »Kommunikation« verbindet Wissen aus solch einzelnen Feldern: Die Dramaturgie aus dem Deutschunterricht, Interpretationen filmischer Werke oder Serien im Fach Kunst, die Erkenntnisse um das duale Rundfunksystem und wirtschaftliche Grundkenntnisse sorgen dafür, dass man zum Beispiel erkennen könnte, wie sehr etwa auf Twitter serielle Cliffhanger genutzt werden: Damit wir alle» dran bleiben«, damit bedauerlicherweise selbst gemäßigte Kräfte populistische Aussagen verbreiten.
Mit dieser Aufklärung könnten entsprechende Ketten durchbrochen, zumindest verstanden werden. Insofern ist ein solches Fach auch für ein Miteinander, ein demokratisches Zusammenleben hilfreich, weil Zusammenhänge in ihrer Komplexität besser einzuschätzen wären. Mindestens kann hinsichtlich Digital- oder Medienkompetenz erreicht werden, dass wir mal das Handy weglegen, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, alle Medien mal ausprobieren, bevor wir sagen, »Lies lieber mal ein Buch!«, dass wir Fake News besser erkennen und selbstständig Sachverhalte anhand seriöser Quellen überprüfen … Dazu gehört auch eine umfassende politische Kommunikation: Sachverhalte werden einereits komplexer, anderseits wird ihre Komplexität den Menschen offenbarer (eben durch die vielen Medien, da es nicht mehr eine Selektion von Nachrichten wie einst durch wenige Kanäle automatisch bedingt gibt). Gerade die Corona-Krise zeigt, dass es oft besser und notwendig ist, Sachverhalte durchaus umfassender zu erklären und aufzubereiten: Damit würde vielleicht auch der Mund-und-Nasen-Schutz nicht so oft hinterfragt —etwa indem man deutlicher (und nicht nur sitzend und verbal auf der Bundespressekonferenz) zeigt, was erreicht wird und wie tatsächöich gefährlich Corona ist. Das Fach wäre ein Gewinn für alle Berufsfelder, für Alt und Jung gleichermaßen. Bis es aber soweit ist, ist Eigeninitiative gefragt. ![]()